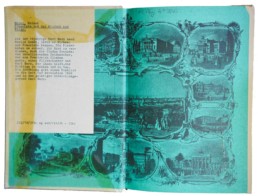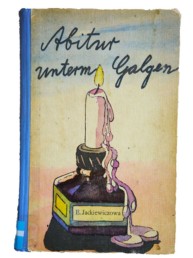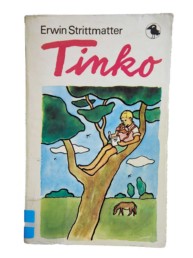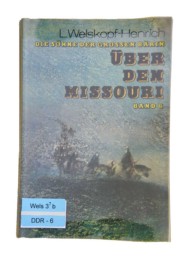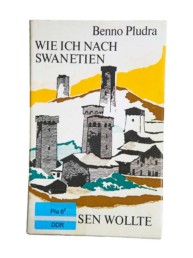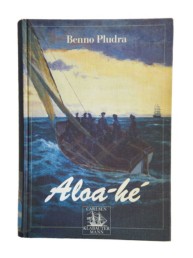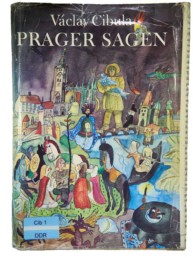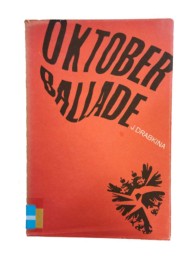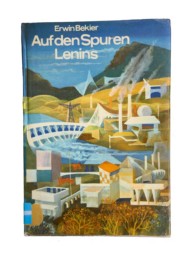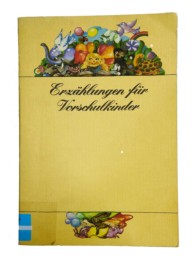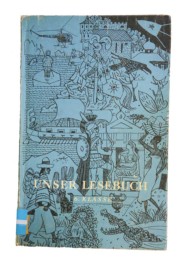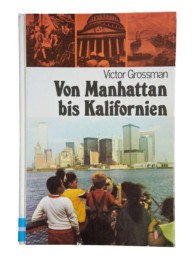„Erich, es ist Schluss“ - 30 Jahre Mauerfall
Vor dreißig Jahren geschah, was man beinahe nicht mehr zu hoffen wagte: Die Mauer fiel, die die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, trennte. Dazwischen war eine streng bewachte Grenze. Die Stadt Berlin war durch eine hohe Mauer zweigeteilt. Gleichzeitig war die rund 160 Kilometer lange Mauer Symbol des Kalten Krieges. Sie fiel am 9. November 1989. Zuvor hatten massenhafte Proteste der ostdeutschen Bevölkerung mit ihrer Forderung nach Freiheit die Regierung der DDR unter Druck gesetzt. Zeitzeugen und WissenschaftlerInnen der Uni Köln beleuchten die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln, mal ganz persönlich, mal wissenschaftlich oder anekdotisch.
- Mauerbau - Mauerfall - Prof. Jost Dülffer, Historisches Institut, erklärt wie es zum Bau und Fall der Mauer kommen konnte
- Meine Erinnerung an den Mauerfall - Zwei internationale Wissenschaftler schildern ihre Erlebnisse 1989
- "Das hatten wir uns in der Studiobühne so schön gedacht..."- Wie ein Theaterprojekt von der Geschichte überrumpelt wurde
- "Für uns heißt es auch...vieles nicht mehr da" - Studierende aus der ehemaligen DDR und ihr Verhältnis zur Wiedervereinigung
- Spiegel der Gesellschaft - Kinder- und Jugendliteratur in der DDR
- "Erich, es ist Schluss" - Professor Dr. Ralph Jessen, Neuere Geschichte erklärt, weshalb niemand in der Staatsführung der DDR auf den Knopf der Eskalation drücken wollte
Mauerbau – Mauerfall
Professor Dr. Jost Dülffer, Historisches Institut, beleuchtet die politische Situation, die zum Bau der Mauer und schließlich zu ihrem Fall geführt hat.
Die Errichtung der Sperranlagen zwischen der DDR und West-Berlin seit dem 13. August 1961 schockierte die Deutschen; die Überwindung der Mauer am 9. November 1989 wurde zu einem Tag weltweiter Freude. Bilder vom Brandenburger Tor in beiden Situationen wurden seit jenen Tagen zu den ikonischen Zeichen des Kalten Krieges, global verbreitet und rezipiert. Der Mauerbau selbst war für die sowjetische Führung unter Nikita S. Chruschtschow nur die zweitbeste Lösung gewesen; seit längerem hatte er als Ziel eine gleichberechtigte Anerkennung der DDR unter indirektem Anschluss auch West-Berlins verkündet; durch den Bau der Mauer konnte sich der ostdeutsche Staat aber nun anscheinend konsolidieren, ein Staat, den bisher durch eine Abstimmung mit den Füßen Millionen Menschen verlassen hatten.


Ein Jahrzehnt später, mit den Ostverträgen der Bundesrepublik und den sie begleitenden Abmachungen der vormaligen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges wurden zwei deutsche Staaten gleichberechtigte Mitglieder der Staatengemeinschaft; der Status West-Berlins blieb international gesichert. Damit war äußerlich der Punkt erreicht, an dem der Kalte Krieg in der Mitte Europas eingefroren und der Status quo der Teilung und Europas und Deutschlands gesichert war, der Antagonismus überwunden werden konnte. Blutige und verlustreiche Konflikte und Kriege hatten stattdessen sich mittlerweile in die außereuropäische Welt verlagert. Dekolonisierung lautete der welthistorische Vorgang, der immer mehr durch die die konkurrierenden Ordnungskonzepte von Ost und West aufgeladen wurden. Der Vietnam-Krieg der sechziger und frühen siebziger Jahre war der markanteste unter ihnen. Den Status quo anzuerkennen, um ihn zu überwinden, war allerdings das Stichwort Egon Bahrs für die Ostpolitik der sozialliberalen Regierung seit 1969. Bei allen Unterschieden der Gesellschaftsordnungen und Ideologien in Ost und West sollten beide Seiten gerade angesichts des Nuklearwaffenpotenzials in einem alles vernichtenden Weltkrieges zu einem entspannten Miteinander finden.
Angst vor militärischer Niederschlagung
Das war nicht immer so gewesen; die Beispiele der Vergangenheit schreckten, denn die Sowjetunion hatte Volksaufstände in der DDR 1953, Ungarn 1956 und dann noch einmal in der CSSR 1968 militärisch niedergeschlagen. In der Tat war die sowjetische Herrschaft in Ostmitteleuropa eine Folge des Zweiten Weltkrieges, eine Herrschaft, mit der sich die dortigen sozialistischen Staaten mangels Alternative zu arrangieren wussten. Als sich erneut, diesmal in Polen Ende der 1970er Jahre, mit der Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc Teile der Gesellschaft gegen das Regime wandten, glaubte man weithin erneut an die Gefahr einer militärischen Niederschlagung durch die Sowjetunion. Doch die Zeiten hatten sich geändert: Moskau entschied sich 1980 wie 1981 gegen eine militärische Lösung und überließ der polnischen Regierung die Unterwerfung der Bewegung mittels Verhängung des Kriegsrechts. Doch die Zeiten hatten sich gewandelt: in Polen, in je unterschiedlichem Maße auch in anderen „sozialistischen Staaten“ Europas blieben Bürgerbewegungen latent erhalten.
Perestrojka
Das wurde in diesen Jahren nur zum Teil öffentlich bewusst, denn eine neue Weltkrise drohte sich in Europa wegen neuer Raketenrüstungen zu entzünden: die Aufstellung neuer sowjetischer, dann auch amerikanischer Mittelstreckenraketen schien vielen Menschen im Westen wie im Osten nicht nur eine Spirale kostspieliger Hochrüstung zu drehen, sondern eine konkrete Atomkriegsgefahr zu signalisieren: das atomare Patt sollte anscheinend durch neue Optionen zur Kriegführung durchbrochen werden. In Massendemonstrationen äußerte sich die Angst vor einem Atomkrieg in Europa. Doch dieser neue Kalte Krieg wurde nach ein paar Jahren überwunden. Trotz Stationierung neuer Raketen in Europa und aggressiver US-Rhetorik, die scheinbar den Antagonismus zwischen Ost und West unüberbrückbar werden ließ, kam es langsam zu neuen, bislang für kaum möglich gehaltenen Entwicklungen, die zu einer mentalen Annäherung, ja zu begrenztem Vertrauen führten. Ausschlaggebend war die Einsicht in die verkrusteten Strukturen des sowjetischen Systems, die sich unter dem neuen Generalsekretär der KPdSU Michael Gorbatschow seit 1985 entfalteten. Die umfassenden Reformen zur Modernisierung des Sowjetsystems im Inneren, Perestrojka genannt, wurden begleitet von der Einsicht in Unsinn und Kosten der Hochrüstungen. Hierin traf er sich mit US-Präsident Ronald Reagan. Beide schlossen am 8. Dezember 1987 einen Vertrag zur Abschaffung aller Mittelstreckenraketen (INF), der Waffe, welche die Krise noch wenige Jahre zuvor hatte eskalieren lassen. Die lange gehegten Erwartungen, dass sich auch die sozialistischen Systeme, voran die Sowjetunion zu einem friedlichen Nebeneinander mit den westlichen Staaten wandeln würden, schienen sich nun zu verwirklichen. Öffentliche Aufforderungen wie die Ronald Reagans am Brandenburger Tor am 12. Juni 1987, Gorbatschow solle die Mauer niederzureißen, liefen in dieser Perspektive allerdings für Viele provokativ auf eine Stärkung der Gegner der sowjetischen Reformen hinaus.
Der politische und gesellschaftliche Umbau in der Sowjetunion ermöglichte eine entsprechende Freisetzung von Reformen auch in den anderen Staaten des sowjetischen Herrschaftssystems und kam seit der zweiten Jahreshälfte 1989 in pluralistische Regierungswechsel, voran in Polen und Ungarn, bis Ende des Jahres auch in allen anderen „Volksdemokratien“ zustande.
Von der Reisefreiheit zur Wiedervereinigung
Die Möglichkeit von Gewalt zur Herrschaftssicherung lag in der Luft, wurde aber nur an einigen Stellen angewandt. Die ursprünglich von der DDR beabsichtigten Maßnahmen zur Grenzöffnung suchten den durch Massendemonstrationen gekennzeichneten Vertrauensverlust zu kanalisieren. Doch bedeutete die Verkündung der unmittelbaren Reisefreiheit und damit die sofortige Öffnung der Grenze in der Nacht des 9./10. November 1989 in der Folge die Implosion der DDR. Anders als in den meisten anderen national verfassten Staaten Ostmitteleuropas hatte die DDR jedoch keine Chance als zweiter freiheitlicher Nationalstaat zu überleben. Die Vereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 war die Folge. Die anderen bisherigen Ostblockstaaten fanden Wege zu freien Wahlen und Demokratie; die Sowjetunion selbst löste sich in diesem Rahmen Ende 1991 auf. Der bisherige Ost-West-Konflikt war zu Ende.
Meine Erinnerung an den Mauerfall
An der Universität arbeiten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit internationaler Herkunft. Wir haben zwei Wissenschaftler aus der ehemaligen Tschechoslowakei und den USA zu ihren Erlebnissen 1989 befragt.

Professor Dr. Stanislav Kopriva, stellvertretender Sprecher des Exzellenzclusters CEPLAS

Professor Dr. Kirk Junker, Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht
Das hatten wir uns in der Studiobühne unserer Universität so schön gedacht…
Dietmar Kobboldt, Leiter der Studiobühne der Universität, über ein deutsch-deutsches Theater-Projekt, das von der Geschichte überrumpelt wurde.
Nachdem wir 1982 die Tradition des legendären Studententheaterfestivals von Erlangen in Köln reanimiert hatten, wuchs schnell der Wunsch nach einer Internationalisierung, die wir 1987 mit unserem ersten binationalen, unserem polnisch-deutschen Theater-Festival realisierten. Der große Erfolg dieser ersten binationalen Begegnung ließ schon bald die Vision eines deutsch-deutschen Theater-Festivals Gestalt annehmen.
Aus heutiger Sicht klingt das natürlich eher so, als würden wir Kolleg*innen aus Düsseldorf nach Köln einladen, aber Ende der 80er Jahre war es ein Wagnis. Uns wurde ebenso mit Skepsis wie mit großem Respekt begegnet, wollten wir doch nicht Rentnerinnen und Rentner aus der DDR einladen, sondern junge, sozialistisch geprägte Menschen – und diese wollten am Ende gar nicht mehr zurück hinter den antifaschistischen Schutzwall. Seitens der BRD war das natürlich alles ganz einfach, uns wurden die Türen nicht nur aufgehalten, wir wurden geradezu hindurch gestoßen. Insbesondere das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen (ja, das gab es tatsächlich) signalisierte großartige, auch finanzielle Unterstützung und Rita Süßmuth, als Präsidentin des Bundestages immerhin die zweithöchste Repräsentantin unserer Republik, übernahm gern die Schirmherrschaft. Aber auch seitens der DDR-Obrigkeit erhielten wir weniger Widerstand, als erwartet. Auch von dieser Seite bewegte sich alles auf eine erfolgreiche Realisierung des deutsch-deutschen Festivals zu.
Was für eine Idee, was für ein Unterfangen, was für ein Beitrag zur Völkerverständigung insbesondere zwischen jungen Menschen. Welche Preise schwebten nicht schon vor unseren organisatorischen Augen? Welches Lob, welche Auszeichnung würden der Studiobühne und unserer Universität nicht zuteil? So, wie wir die innerdeutsche Grenze überwinden wollten, wuchsen auch unsere Vorstellungen an den Erfolg ins Grenzenlose und die europaweite Berichterstattung in allen Medien leuchtete schon in schwarz-rot-güldenen Farben vor unseren Augen.
Und dann fiel die Mauer
Nun ja, sie kippte nicht einfach so um, sondern bekam Löcher, durch die Hunderttausende unserer Brüder und Schwestern aus dem Osten in ihren Trabis zu uns in den Westen kamen. Wie haben wir die Feinstaubbelastung damals mit Tränen in den Augen bejubelt. Und es kamen wirklich viele, und alle nahmen dankend ihr Begrüßungsgeld von 100 westdeutscher Mark entgegen – und fuhren wieder zurück. Den Feinstaub ließen sie natürlich hier.
Zeitnah signalisierte uns das Ministerium, dass es mit dem üppigen Zuschuss ganz so toll nun nicht mehr würde, aber in dieser historischen Situation hätten wir sicher Verständnis…
Und die Medien? Nett, das auch wir uns jetzt um die junge Theaterkunst der DDR kümmern würden, aber eine exklusive Berichterstattung über etwas, das nun wirklich nicht mehr exklusiv war…? In dieser historischen Situation hätten wir sicher Verständnis…
Die Schirmherrschaft von Rita Süßmuth blieb natürlich bestehen, aber eine persönliche Anwesenheit der Präsidentin des Deutschen Bundestages zur Festivaleröffnung? In dieser historischen Situation hätten wir sicher Verständnis…
Das Festival selbst fand dann natürlich trotzdem statt und wir hatten durchaus noch Glück, denn im März 1990 gab es tatsächlich noch zwei deutsche Staaten. Und es war auch eine spannende, inhaltlich kontroverse Woche des Austauschen zwischen zwei völlig gegensätzlichen Theatervorstellungen: vorsichtige politische Kritik an den waltenden Umständen der DDR auf der einen Seite, kühne Formexperimente auf unserer Seite; auch hier musste noch zusammenwachsen, was zusammen gehört, denn das Volk der Dichter und Denker wurde ja nie wirklich geteilt. Und bei der (Theater-) Kunst ist in den letzten 30 Jahren viel mehr gelungen, als im politischen Alltag.
Und auch die Presse berichtete – im lokalen Kulturteil. In dieser historischen Situation hatten wir natürlich Verständnis…
„Für uns heißt es auch…vieles nicht mehr da“
In einem Podcast, das TeilnehmerInnen des Studiengangs Intermedia gedreht haben, schildern Studierende aus der ehemaligen DDR, wie die Wiedervereinigung sie geprägt hat.

Was bedeutet der Mauerfall für die Studierenden von heute? // Vorsicht Podcast! WiSe 19/20
Kinder- und Jugendliteratur der DDR – Spiegel der Gesellschaft
Umfangreiche Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“ in der ALEKI-Bibliothek
Nur wenigen ist bekannt, dass es in der Universität eine Sammlung mit rund 2.100 Titeln der Kinder-, Jugend- und Bilderbuchproduktion der DDR gibt. Die Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“ gehört zur Bibliothek der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung (ALEKI). In der Sammlung befinden sich auch zahlreiche übersetzte Werke der Kinder- und Jugendliteratur aus der früheren Sowjetunion und osteuropäischer Staaten. In ihrer Vielfalt liefert die Sondersammlung ein repräsentatives Bild der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) von den Anfängen der DDR bis zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik im Jahr 1990. Zahlreiche Kinder- und Jugendbücher der ehemaligen DDR wurden seit der Wende neu aufgelegt und können wieder als frisch gedruckte Werke über den Buchhandel erworben werden.
In den KJL-Werken der Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“ spiegelt sich die gesellschaftliche Entwicklung der DDR wider. Die Kinder- und Jugendliteratur, einschließlich der Schulbücher, wurde in der DDR oftmals als Medium genutzt, um Heranwachsenden die Wertvorstellungen einer sozialistischen Gesellschaft zu vermitteln und sie zu einer „sozialistischen Persönlichkeit“ zu erziehen. Der Versuch, gesellschaftliche Wertvorstellungen über Literatur zu transportieren, trifft auch für viele Veröffentlichungen von Kinder- und Jugendliteratur der BRD zu. In den Werken der DDR war beispielsweise die Berufstätigkeit der Mütter und die Betreuung in einer Kinderkrippe ein Thema. Analog dazu thematisierte die KJL der BRD die Betreuung der Kinder durch die nicht berufstätige Mutter im eigenen Zuhause. Das unterschiedliche Rollenverständnis von Frauen bzw. Müttern in beiden Gesellschaftssystemen fließt somit ein in die Geschichten für Kinder und Jugendliche.
Um die Erziehung zur „sozialistischen Persönlichkeit“ sicherzustellen, wurden Produktion und Vertrieb von Literatur in der DDR – anders als in der BRD – staatlich kontrolliert. „Autoren mussten unter Umständen vor der Veröffentlichung mit der Zensur ihrer geschaffenen Werke rechnen. In der BRD gab und gibt es dagegen vor der Veröffentlichung eines Werkes keine staatlichen Institutionen mit der Befugnis zur Zensur. Allerdings ist es in der BRD möglich, dass ein Werk nach seinem Erscheinen im Rahmen des Jugendschutzgesetzes indiziert wird, etwa wenn es Gewaltexzesse oder Pornographie enthält“, erläutert der Bibliothekar Thomas Fischer.
Die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung (ALEKI) im Institut für Deutsche Sprache und Literatur II betreibt Grundlagenforschung zur Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur (KJL), zu Bilderbüchern und Comics, zur Jüdischen Kinder- und Jugendliteratur (Datenbank „Schatzbehalter“) sowie zur Didaktik der KJL. Die ALEKI verfügt über eine wissenschaftliche Spezialbibliothek, die reichhaltige Bestände an historischer und aktueller Kinder- und Jugendliteratur sowie eine Filmsammlung umfasst. Hierzu zählen auch die 2.100 Werke der Sondersammlung „DDR-Kinderbuch“.
Die 50er: Kollektiv vor Individuum
Besonders in den 1950er und 60er Jahren war die KJL der DDR stark ideologisch geprägt. Kinder und Jugendliche sollten eigene Bedürfnisse zurückstellen und sich in die staatlich organisierten Kollektive einbringen. Es galt, Kinder und Jugendliche für die Angebote der staatlichen Institutionen zu begeistern, mit denen die sozialistische Ideologie verbreitet wurde. Im Jahre 1954 erschien beispielsweise der Roman „Tinko“ von Erwin Strittmatter. Der Junge Tinko, der in einem Dorf bei seinen Großeltern lebt, muss sich in dieser Geschichte zwischen seinem Großvater und seinem aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Vater entscheiden. Thematisiert werden in dem Werk insbesondere die Konflikte zwischen den Generationen sowie zwischen „Altem“ und „Neuem“, zum Beispiel in Bezug auf die Bodenreform und die Kollektivierung in der Landwirtschaft. Letztendlich siegt in dem Roman das Neue, die Kollektivierung der Landwirtschaft wird als Erfolg dargestellt.
Viele Werke aus dieser Zeit thematisierten den Antifaschismus, Antiimperialismus und den Klassenkampf. „Die auch im Westen sehr beliebten und häufig verfilmten Märchenbücher aus der DDR, der Sowjetunion und osteuropäischen Ländern waren dagegen kaum ideologisch geprägt und wurden in der Regel weniger streng begutachtet“, sagt Fischer.
Die literarisch eher einfach strukturierten, meist auf dem Dorf spielenden Werke der 1950er Jahre präsentieren überwiegend kindliche bzw. jugendliche Vorbildfiguren, die sich ganz in den Dienst des „sozialistischen Aufbaus“ stellen, aber auch Außenseiter, die sich erst allmählich in das Kollektiv eingliedern. Ende der 1960er Jahre rückt die Individualität des Kindes stärker in den Vordergrund, der starke Optimismus der Aufbaujahre schwindet langsam.
Die 70er: zunehmend gesellschaftskritisch
Im Laufe der 1970er Jahre wird die KJL zusehends gesellschaftskritischer. Notwendige gesellschaftliche Veränderungen werden in den Werken thematisiert. Bedrohungen, die von der Welt der Erwachsenen für die Kinder und Jugendlichen ausgehen, werden zum Thema in den Werken. Allgemeine Missstände im Land werden erwähnt, sozialistische Werte hinterfragt und neue Werte, wie z.B. Gerechtigkeit und Partizipation, diskutiert. Zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren der DDR zählt Benno Pludra. In seinem 1974 erschienenen Buch „Wie ich nach Swanetien reisen wollte“ schildert er seine eigenen Erlebnisse von einer Reise nach Swanetien in dem damals zur Sowjetunion gehörenden Georgien. Tatsächlich ist Pludra durch die Sowjetunion nach Georgien gereist, er hat die seinerzeit für Ausländer kaum zugängliche Kaukasus-Region Swanetien allerdings nie erreicht. Pludra schildert die Eindrücke seiner Reise und reflektiert dabei die Kultur der Länder der Sowjetunion vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebenserfahrung in der DDR.
Die 80er: personale und komplexere Erzählstrukturen
Der bis dahin die KJL der DDR prägende auktoriale Erzählstil tritt im Laufe der 1970er Jahre und vor allem in den 1980er Jahren zugunsten personaler und komplexerer Erzählstrukturen zurück. In den 1980er Jahren werden einige kritische Werke veröffentlicht, in denen bis dahin geltende Tabus angesprochen wurden. „In dieser Zeit erscheinen in der DDR auch immer häufiger Veröffentlichungen westdeutscher Kinder- und Jugendbuchautoren, wie beispielsweise das Buch ‚Rolltreppe abwärts‘ von Hans-Georg Noack“ oder ‚Es geschah im Nachbarhaus‘ von Willi Fährmann, so Fischer – vielleicht ein Zeichen für eine stärkere kulturelle Öffnung und Annäherung an die BRD…?
Cover-Auswahl Kinder- und Jugendliteratur der DDR
„Erich, es ist Schluss. Wir können nicht anfangen, mit Panzern zu schießen“
Weshalb schoss die Stasi nicht? Wieso fuhren keine Panzer auf? Wer während des Kalten Krieges aufwuchs, erlebte die DDR als monolithische Herrschaft der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), die wie 1953 auch mit gewaltsamen Mitteln aufrechterhalten wurde. Doch warum setzte die SED nicht ihren Sicherheitsapparat in Gang und unterdrückte die Oppositionsbewegung? Was bewirkte, dass die SED vor den andrängenden Menschenmengen am Brandenburger Tor am 9. November 1989 sang und klanglos kapitulierte? Professor Dr. Ralph Jessen, Professor für Neuere Geschichte erklärt, weshalb niemand in der Staatsführung der DDR auf den Knopf der Eskalation drücken wollte.
Herr Professor Jessen, angesichts der langen monolithischen Herrschaft der SED in der DDR fragt man sich, warum das Ende so relativ gewaltfrei vonstattengegangen ist. Wie ist es schließlich zur Entscheidung gekommen, keine Gewalt einzusetzen? Gab es für die DDR-Führung einen Point of No Return?
Ein erstes wirklich einschneidendes Datum war der 9. Oktober, als die SED-Parteiführung und der gesamte staatliche Apparat darauf verzichteten, die Leipziger Montagsdemonstrationen gewaltsam zu beenden. Im Vorfeld dieses 9.Oktobers sind definitiv Vorbereitungen getroffen worden, die Demonstrationsbewegung zu unterdrücken, unter Umständen auch unter Einsatz von Gewalt. An diesem Montag haben in Leipzig an die 70.000 Menschen in dem Bewusstsein demonstriert, dass die Lage gewaltsam eskalieren könnte. Es ist dann aber nicht zu der gewaltsamen Niederschlagung gekommen.
Wieso hat die SED auf die gewaltsame Unterdrückung der Opposition verzichtet?
Es war längere Zeit unklar, warum das eigentlich so kam. Letztlich war es eine Situation, in der keiner der Verantwortlichen eine Entscheidung gefällt hat. Nicht in Leipzig, in der SED-Bezirksleitung, aber auch nicht in Berlin, im SED-Politbüro. Man scheute vor einer Entscheidung zurück und dann war die Sache irgendwann gelaufen. Das ist der Zeitpunkt, von dem ab erkennbar wurde, dass eine gewaltsame Niederschlagung für die Parteiführung keine Option mehr war. Wenige Tage vorher, am 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der Republikgründung, hatte es ja in Berlin unter den Augen Gorbatschows gewaltsame Maßnahmen gegen Demonstranten gegeben, was große Empörung hervorgerufen hatte. Zwei Tage später verzichtet man darauf. Das ist ein Indiz für eine grundlegende Verunsicherung der Parteiführung – von da ab ist die gewaltsame Niederschlagung keine Option mehr.
War das von da an die konsequente Politik des Politbüros?
Das kann man ein paar Tage später am 17. Oktober sehen, als das Politbüro der SED den Sturz Honeckers betreibt. Da gibt es eine Debatte im Politbüro zwischen Krenz und seinen Leuten und Honecker. Honecker lavierte und war überrascht. Und dann äußerte sich einer nach dem anderen. Unter anderem der Stasi-Chef Mielke, der sagte: „Wir können doch nicht anfangen, mit Panzern zu schießen. Erich [es ist] Schluss.“ Das war ein zweites Datum, als auf der Top-Ebene klar wird, dass man eine gewaltsame Lösung, mit der man gedroht hatte, nicht herbeiführen will. Kurz darauf, am 4. November, zeigte die große Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz, dass der öffentliche Massenprotest mitten in der Hauptstadt angekommen und die Dynamik der Demonstrationsbewegung nicht zu bremsen war. Also: Zwischen dem 9. Oktober und dem 4. November war der Zusammenbruch schon entschieden. Mir ist nicht bekannt, dass es am 9.November noch eine Option gegeben hätte, die Entwicklung gewaltsam niederzuschlagen.
Wie ist denn der Bewusstseinswandel im Politbüro vonstattengegangen? Ist das die mangelnde Rückendeckung der Sowjets gewesen, der allgemeine Druck aus dem Ausland? Hatte der Staat einfach das Vertrauen in sich selbst verloren? Weshalb will man sich nicht mehr entscheiden? Gab es keine Absprachen?
Unterschiedliche Faktoren spielen eine Rolle. Gorbatschow hatte die Breschnew-Doktrin von der beschränkten Souveränität der Ostblock-Staaten aufgekündigt, die bedeutete, dass Moskau sie im Zweifelsfall wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen würde. Gorbatschow hatte klargemacht: Was auch immer bei Euch passiert, wir intervenieren nicht. Damit entfiel die äußere Bestandsgarantie für die kommunistischen Regimes der Ostblockstaaten, die es durch die militärischen Interventionen 1953 für die DDR, 1956 für Ungarn und 1968 für die Tschechoslowakei gegeben hatte. Die SED war gezwungen auf eigene Rechnung und Verantwortung zu agieren.
Man kann aber auch eine zunehmende Entscheidungsblockade an der Spitze des Staates erkennen. Honecker war krebskrank und im Sommer 1989 mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. In diesem hochgradig zentralisierten Entscheidungsapparat spielte es eine große Rolle, ob der oberste Entscheider an Deck ist oder nicht. In der zweiten Reihe breitete sich Unsicherheit aus, wie Entwicklungen wie die Ausreisewelle zu beherrschen seien. Und obwohl man mit der „chinesischen Lösung“ gedroht hatte, war doch die Bereitschaft, exzessive Gewalt einzusetzen, gering. Man kann außerdem beobachten, wie sich die wachsende Unsicherheit bis in den Sicherheitsapparat des Staates und der SED ausbreitete.
Seit wann hat diese Erosion eingesetzt? War das nur ein Phänomen des Jahres 1989 und des Machtvakuums an der Spitze?
Die Erosion des Glaubens an den Sozialismus à la DDR und der Identifikation mit dem Regime hatte schon lange vorher in den 80er Jahren eingesetzt. Die SED lief zu dieser Zeit schon seit langem in einer Art Routinebetrieb. In den 50ern und 60ern war es noch das utopische Moment, dass den Staat antrieb: das Versprechen einer besseren Gesellschaft, des Sozialismus. Das war unter Honecker weitgehend dahin. Man versuchte die Sache am Laufen zu halten und war seit der Wirtschaftskrise Ende der 70er Jahre mit Krisenmanagement beschäftigt. Man hatte kein halbwegs glaubwürdiges Identifikationsangebot für die Menschen mehr. Das war ein langfristiger Utopieverlust und damit ein Verlust an Glaubwürdigkeit selbst bei den SED-Mitgliedern. Und das traf auf die Situation einer eskalierenden Krise, in der wieder so etwas wie zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit entsteht. Und man wusste nicht, wie man damit umgehen soll: Die Kaltblütigkeit zur massiven Repression brachte man nicht mehr auf, der Glaube an die eigene Sache war zutiefst verunsichert und man merkte, dass die Altherren-Riege unflexibel wird. So sickerte die Blockade in die Apparate hinein.
Gab es auch Hardliner, die 1989 noch ein gewaltsames Vorgehen befürworteten?
Verteidigungsminister Kessler war eher einer der Hardliner aber auch er hat nicht gesagt: „Nun lasst uns die Kasernentore öffnen.“ Es hätte auch anders kommen können, wenn man auf den Knopf hätte drücken wollen, denn die Sicherheitsapparate waren hochgerüstet. Aber auf diesen Knopf wollte keiner drücken. Die Betonköpfe verloren das Momentum.
Seit den 90er Jahren weiß man, wie groß und mächtig die Stasi wirklich war. Hätte das MfS nicht auf eigene Rechnung intervenieren können?
Nein. Bis zum Ende wurde der politische Entscheidungsprimat nicht in Frage gestellt. Weder das Ministerium für Staatssicherheit noch das Militär konnten oder wollten eigenständig intervenieren.
Kommen wir zur Nacht des Mauerfalls. Damals konnten die Grenzoffiziere keine Entscheidungen mehr von ihren Vorgesetzten erhalten. Ist das auch ein Zeichen der von Ihnen beschrieben Blockade im System?
Das sind Zeichen der chaotischen Situation in der Führung des Staates. Die bekannte Pressekonferenz mit Günter Schabowski ist ein Beispiel dafür, dass die politische Kommunikation nicht mehr funktionierte. Man war nicht mehr in der Lage, klare Ansagen zu machen. Dazu kommt, dass man sich in einer vollkommen ungewohnten Situation befand: Die DDR-Parteiführung war 40 Jahre lang daran gewöhnt gewesen, in hoch bürokratischen Abläufen zu agieren und ausgefeilte Statements zu machen. Doch dann entstand plötzlich so etwas wie eine nicht kontrollierte Öffentlichkeit und man musste sich spontan äußern. Und so kam es dann zu der legendären Äußerung Schabowskis. Hinzu kamen die westlichen Medien, die die Nachricht verbreiteten, die Mauer sei bereits offen, und dann geschah das, was wir alle wissen.
Weshalb hat das Politbüro sich entschieden, die Grenzen zu öffnen?
Was wir 1989 beobachten können, war die bemerkenswerte Parallelität zweier gleichzeitiger Entwicklungen: Zum einen drängten viele oft unpolitische „kleine Leute“ aus dem Staat heraus und gleichzeitig gab es immer mehr Menschen, die sagten: „Wir bleiben hier und wollen grundsätzliche Änderungen in der DDR.“ Oft in der Geschichte gibt es in Krisensituationen entweder das eine oder das andere: „Exit“ oder „Voice“. Hier verstärkte sich beides gegenseitig. Wenn die Führung der DDR mit dieser explosiven Situation umgehen wollte, musste die Reisefrage geregelt werden. Das geschah auch, um Druck aus dem Kessel zu lassen. Die Grenzfrage war letztlich die entscheidende Frage. Als die Grenze offen war, war nicht nur das Schicksal des SED-Regimes, sondern auch das der DDR entschieden.
Texte: Anneliese Odenthal, Robert Hahn, Mathias Martin, Anette Hartkopf, Jürgen Rees
Bild/Video: Wikimedia Commons, Adam Polczyk, Janine Klösges, Mathias Martin
Website Konzept, Technik, Gestaltung: Anette Hartkopf