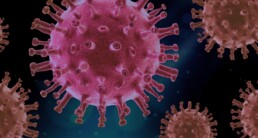Entziffert: Die »unbekannte Kuschana-Schrift«
Kölner Linguisten lösen das Rätsel um ein 2000 Jahre altes Schriftsystem
Vieles von dem, was heute über das Kuschana-Reich und seine Einwohner bekannt ist, stammt aus chinesischen, griechischen oder römischen Quellen. Einen Teil der Schriftzeugnisse dieser zentralasiatischen Kultur konnte bislang niemand lesen, denn das Schriftsystem, in dem sie verfasst waren, war nicht entziffert. Den Kölner Linguisten Svenja Bonmann, Jakob Halfmann und Natalie Korobzow ist nun der Durchbruch gelungen: das Rätsel der unbekannten Kuschana-Schrift ist gelöst.
Ein mächtiges Reich, von Nomaden gegründet
Das Kuschana-Reich lag im Zentrum der antiken Welt zwischen dem Römischen Reich und China. Heute liegt der größte Teil des ehemaligen Reiches in Afghanistan, aber auch in Teilen Tadschikistans und Usbekistans sowie Pakistans, Nordindiens und des westlichen Chinas.

Wikipedia.org, public domain: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115482936
Kern des Reiches war Baktrien, das heißt die Ländereien und städtischen Siedlungen entlang des Mittellaufs des Flusses Oxus bzw. Amu Darya.
Ca. 500 v. Chr. eroberten die Perser das Gebiet, 200 Jahre später fiel Alexander der Große dort ein. Nach Alexanders Tod konnten die Herrscher des Graeco-Baktrischen Reichs dort für knapp 175 Jahre einen Außenposten griechischer Kultur etablieren, dessen hellenistisches Erbe noch lange nachwirkte.
Ungefähr zur Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. wurde Baktrien durch die Yuèzhī erobert. Die Yuèzhī waren eine nomadische Stammeskonföderation der zentralasiatischen Steppe. Ursprünglich lebten sie in einem Gebiet, das heute politisch zu China gehört (im sogenannten Gansu-Korridor), erlitten jedoch im frühen 2. Jahrhundert v. Chr. eine militärische Niederlage durch die sogenannten Xiōngnú. Die Yuèzhī flohen über Zwischenstationen nach Nordbaktrien, ließen sich dort nieder und einer ihrer Teilstämme, die Kuschana, gründete schließlich das Kuschana-Reich.
Die religiöse Kultur in diesem Reich war von einem Zusammenwirken von hellenistischen, hinduistischen und altiranischen Einflüssen geprägt, daneben waren die Kuschana auch maßgeblich für die Verbreitung des Buddhismus in Zentralasien und China verantwortlich.
Zeugen des Kuschana-Reichs
Bildnachweis: public domain via wikimedia commons (1) Surkh Kotal: https://en.wikipedia.org/wiki/Surkh_Kotal#/media/File:Staircase,_Surkh_Kotal,_2%E2%80%934_century_CE.jpg, (2) Ayaz Kalla: https://en.wikivoyage.org/wiki/Ayaz-Kala#/media/File:Ayaz_Kala_(Khorezm,_Ouzb%C3%A9kistan)_(5608879653).jpg CC BY 2.0 (3) Kampir Tepe: By Stephanieadams99 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/wiki/Kampir_Tepe#/media/File:Kampir_Tepe_Site.jpg
Die Kuschana entsandten Botschafter ins Sassaniden-Reich, ins Kaiserreich China und nach Rom. Damit gehörte ihr Staat zu den mächtigsten Reichen der antiken Welt. Unter Kaiser (oder Großkönig) Kanishka I. erreichte das Reich im 2. Jahrhundert n. Chr. den Höhepunkt seiner Macht. Der Herrscher errichtete eine Sommerresidenz im heutigen Bagram (Afghanistan) und eine Winterresidenz in der Hauptstadt Purushapura (Peschawar, Pakistan). Dort und an anderen Orten des Reichs entstanden riesige Bauwerke und bedeutende Kunstwerke. Durch den langanhaltenden Frieden der Kuschana-Epoche blühten auch Handwerk und Handel auf. Im frühen 3. Jahrhundert zerfiel das Kuschana-Reich und wurde unter anderem vom persischen Sassaniden-Reich erobert.
Eine kleine Schale und ein Seminar über mitteliranische Sprachen
Französische Forscher entdeckten bereits in den 1950er Jahren Zeugnisse der unbekannten Kuschana-Schrift. Seither gab es viele Entzifferungsversuche, doch bislang war keiner erfolgreich.
Svenja Bonmann, Jakob Halfmann und Natalie Korobzow beschäftigen sich seit Jahren mit der unbekannten Kuschana-Schrift. Den Ausschlag gab für Bonmann eine kleine Schale mit den Schriftzeichen, die sie vor zehn Jahren im Deutschen Bergbau-Museum in Bochum sah. Sofort waren ihr Ehrgeiz und ihre Neugier geweckt und der Wunsch und Wille gefasst, diese Schrift eines Tages lesen zu können. Bonmann war sich bewusst, dass sie erst die relevanten Sprachen der Zeit und Region lernen müsse, bevor sie einen ernsthaften Entzifferungsversuch unternehmen konnte. Mit Halfmann und Korobzow fand sie Mitstreiter, die ihre Leidenschaft teilten.
Der konkrete Anlass zum Entzifferungsprojekt war ein Einführungskurs in die mitteliranischen Sprachen, den Bonmann im Sommersemester 2021 am Institut für Linguistik an der Universität zu Köln anbot. Halfmann, der diesen Kurs besuchte, kam auf die bislang unlesbare Schrift Baktriens zu sprechen. Schnell kamen die beiden überein, das Problem anzugehen – natürlich methodisch durchdacht. Bonmann schrieb zu dieser Zeit ihre Dissertation über alt- und mitteliranische Sprachen, Halfmann steuerte fundierte Kenntnisse moderner indoiranischer Sprachen bei. Mit Korobzow fanden sie eine versierte Expertin semitischer Schriften und Sprachen, die sich dem Projekt anschloss. Gemeinsam ergänzten sich die Schwerpunkte der drei Linguisten.
Vema Takhtu, König der Könige
Anhand von Fotografien von Inschriften auf Felswänden oder Steinbrocken sowie Schriftzeichen auf Schalen und Tontöpfen aus verschiedenen zentralasiatischen Ländern versuchte das Team, das Puzzle nach und nach zusammenzufügen.
So wurde es möglich, die wahrscheinliche Schreib- und Leserichtung, die Anzahl und Natur einzelner Schriftzeichen und Diakritika (Vokalzeichen) sowie den wahrscheinlichen Schrifttyp zu bestimmen. Den Schrifttyp identifizierten sie als eine sogenannte Abugida (bzw. ein Alphasyllabar indischen Typs), wobei ein Schriftzeichen für eine Silbe steht. Sie erstellten ein Zeicheninventar und suchten nach wiederkehrenden Sequenzen von Zeichen. Für die phonetische Zuordnung konkreter Lautwerte zu einzelnen Schriftzeichen nutzte die Gruppe dann bereits lesbare Paralleltexte in baktrischer Sprache als Ansatzpunkt – ähnlich, wie beispielsweise Jean-François Champollion vor genau 200 Jahren vorging, als er die ägyptischen Hieroglyphen mittels des Steins von Rosetta entzifferte.
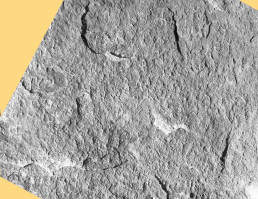
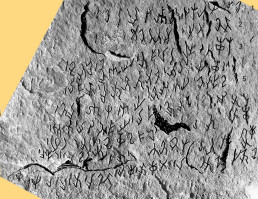
Schriftzeichen auf einem Fels von Dasht-i Nawur, Afghanistan (© Bild: Collège de France; Zeichnung: Natalie Korobzow)
2022 folgte ein Team von tadschikischen Archäologen dem Hinweis des ortsansässigen Geologen Khaitali Sanginov und entdeckte in der Almosi-Schlucht im Nordwesten Tadschikistans einen kurzen zweisprachigen Text (Bilingue), der in eine Felswand geritzt war. Einer von ihnen war der Archäologe Dr. Bobomullo Bobomulloev vom Institut für Geschichte, Archäologie und Ethnographie der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Tadschikistan, der den Fund dokumentierte und fotografierte. Dank dieser Fotos gelang in Köln der entscheidende Erfolg.
Neben der unbekannten Kuschana-Schrift enthält die zweisprachige Inschrift einen Abschnitt in der bereits bekannten baktrischen Sprache. Der baktrische Paralleltext enthält den Königsnamen Vema Takhtu (ca. 100 n. Chr.) und den Titel ‚König der Könige‘. Bonmann, Halfmann und Korobzow hatten die Lautung der Phrase ‚König der Könige‘ in verschiedenen möglicherweise zugrundeliegenden Sprachfamilien rekonstruiert (Tocharisch, Iranisch, Burushaski, Jenissejisch) und sich gleichzeitig überlegt, wie die jeweilige Lautsequenz geschrieben werden müsste – also mit wie vielen Zeichen insgesamt und in welcher Reihenfolge. Als sie Fotos des Neufundes aus Almosi erhielten, konnten sie deshalb sogleich den Namen und Titel in den entsprechenden Abschnitten der unbekannten Kuschana-Schrift ausfindig machen.
Das ergab eine Kettenreaktion, und nach und nach konnten immer neue Zeichensequenzen gelesen werden. Aktuell können die Linguisten ca. 60 Prozent der Schriftzeichen lesen, am verbleibenden Rest arbeitet die Gruppe intensiv.
Eine 2000 Jahre alte mitteliranische Sprache kann wieder gelesen werden
Neben der tadschikischen Bilingue zogen sie auch eine in Afghanistan gefundene dreisprachige Inschrift (Trilingue) in Gandhari/Mittelindoarisch, der baktrischen Sprache und der unbekannten Kuschana-Schrift hinzu. So fanden sie heraus, dass die Kuschana-Schrift eine bislang völlig unbekannte mitteliranische Sprache festhält. Vermutlich nimmt die Sprache eine Mittelstellung in der Entwicklung zwischen dem Baktrischen und dem einst in Westchina gesprochenen sogenannten Khotansakischen ein. Es könnte sich dabei entweder um die Sprache der sesshaften Bevölkerung Nordbaktriens handeln (auf einem Teil des Staatsgebietes des heutigen Tadschikistans) oder um die Sprache einiger Nomadenvölker Innerasiens (der Yuèzhī), die ursprünglich im Nordwesten Chinas lebten. Für einen gewissen Zeitraum diente sie offenbar neben Baktrisch, Gandhari/Mittelindoarisch und Sanskrit als eine der offiziellen Sprachen des Kuschana-Reichs. Vorläufig nennen die drei Forscher die neu identifizierte iranische Sprache „eteo-tocharisch“.
Die Kölner Linguisten planen für die Zukunft in enger Zusammenarbeit mit tadschikischen Archäologen Forschungsreisen nach Zentralasien, da mit Neufunden weiterer Inschriften zu rechnen ist und vielversprechende potentielle Fundstätten bereits lokalisiert sind. Sie sind zuversichtlich, dass die Entzifferung zu einem besseren Verständnis der Sprach- und Kulturgeschichte Zentralasiens und des Kuschana-Reichs führen wird, ähnlich wie es die Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen oder der Maya-Glyphen für unser Verständnis des alten Ägypten oder der Maya-Zivilisation getan haben.
Text:
Svenja Bonmann, Jakob Halfmann, Natalie Korobzow, Eva Schissler
Videos:
Adam Polczyk, Niclas Carl, Christoph Carle
Website Konzept, Technik, Gestaltung:
Anette Hartkopf
Mozarts Requiem – neu vervollständigt
Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ist eines der meistaufgeführten Werke klassischer Musik überhaupt. Bei seiner Aufführung ist allerdings in den meisten Fällen gar nicht das alleinige Werk Mozarts zu hören, denn er hinterließ es unvollendet. Inmitten der Komposition dieser Totenmesse ereilte ihn der eigene Tod. Das Musikstück, das wir heute kennen, komponierte damals Mozarts Werkstattgehilfe Franz Xaver Süßmayr zu Ende. Immer, wenn groß »Mozart« auf dem Plakat und Programm zum Requiem steht, ist also gar nicht nur »Mozart drin«.
Der Komponist und Dirigent Michael Ostrzyga, Kölner Universitätsmusikdirektor und Leiter des Collegium musicum, hat nun einen neuen Ergänzungsversuch von Mozarts Requiem-Fragment vorgelegt.
Fakt und Fiktion: Die Geschichte des Requiems
Um Mozart – und besonders um das letzte Werk des musikalischen Genies – ranken sich allerlei Mythen und Legenden. Die Hollywood-Verfilmung »Amadeus« von Miloš Forman aus dem Jahr 1984 ist das wohl bekannteste Beispiel. Der Film verrührt altbekannte Narrative und ist voll von dramatischen Übertreibungen: Ein anonymer Auftraggeber sichert Mozart gute Bezahlung für die Komposition des Requiems zu. Von Krankheit geschwächt bittet er seinen neidischen Widersacher Antonio Salieri um Hilfe. Dieser plant jedoch im Geheimen, Mozart umzubringen und das Werk bei dessen Totenmesse dann als sein eigenes auszugeben. Mozart wird besessen davon, die Totenmesse für sich selbst noch zu Ende schreiben zu müssen – aber der Tod kommt ihm zuvor.
Derartige Fabulationen haben eine lange Geschichte. Forman hatte für seinen Film vom gleichnamigen Theaterstück Peter Shaffers abgekupfert. Der russische Komponist Nikolai Rimski-Korsakow hatte Salieri bereits 1898 in der Oper »Mozart und Salieri« als Antagonisten ins Spiel gebracht. Diese Oper wiederum basiert auf einem Versdrama des Dichters Alexander Puschkin von 1830. Beispiele wie diese zeigen die Faszination, die die Entstehungsgeschichte des Requiems im Laufe der Zeit auf kreative Köpfe ausübte.

Tatsächlich verbreiteten sich einige Legenden – wie die der mutmaßlichen Vergiftung – schon binnen weniger Wochen nach Mozarts Tod durch Zeitungsberichte in Europa. Im 19. Jahrhundert taucht ein Brief Mozarts auf, der tiefe Einblicke ins Seelenleben des Schöpfers beim Schreiben des Requiems zu geben scheint. Der Brief erwies sich jedoch als Fälschung. Das »Original« davon ist inzwischen selbst verschollen.
Als die Noten des Requiems von Mozart/Süßmayr 1800 erstmals publiziert wurden, geschah dies genaugenommen auch als Fälschung, denn sie wurden als alleiniges Werk Mozarts deklariert. Noch heute fällt der Name Süßmayr in stiller Übereinkunft eher unter den Tisch, wenn von Mozarts Requiem die Rede ist.
Inzwischen konnte die Quellenforschung sicher trennen, was von Mozart geschrieben worden ist und was nicht. Um »Echtheitsfragen« wird jedoch nach wie vor gestritten. Vor allem, wenn es darum geht, wie viel Mozart in den fremden Handschriften stecken könnte.
Es waren viele Fäden, die Michael Ostrzyga entwirren musste. Während seiner Arbeiten holte er sich daher auch Rat und Einschätzungen von verschiedenen Mozart-Forscher:innen rund um den Globus ein, etwa zur Interpretation und Datierung der Quellen, zu Liturgie und Skizzen Mozarts.
Über Mozarts Fragmente und Skizzen, über seine Schaffensweise und sein Vorgehen beim Verschriftlichen von Musik weiß wohl niemand besser Bescheid als der Musikwissenschaftler und Mozartexperte Professor Dr. Ulrich Konrad von der Universität Würzburg.
Die Entstehungsgeschichte Teil 1: Vor Mozarts Tod
Die Entstehungsgeschichte Teil 2: Nach Mozarts Tod

Handwerk und Muse
Michael Ostrzygas Neukomplettierung des Requiems sollte sich über mehr als vier Jahre hinziehen. Was bewog ihn dazu, sich dieser Mammutaufgabe anzunehmen?

Schon als Kind lernte Ostrzyga an der Orgel das Improvisieren und hantierte mit kompositorischen Bausteinen. Auch übte er sich schon im Schreiben von Musik – angelehnt an das, was er hörte. Seit Beginn seines Studiums des künstlerischen Tonsatzes an der Kölner Musikhochschule setzte er sich systematisch mit dem Nachschaffen von Musik auseinander.
Im Tonsatz-Studium durchforstete Ostrzyga Lehrschriften aus der jeweiligen Zeit und analysierte die Musik verschiedener Komponisten – darunter auch Mozart. Damals lernte er, Stil-Imitationen zu schreiben, also durch kreatives Nachschaffen unterschiedliche Tonsprachen genauer zu verstehen. So kann man, wie Ostrzyga sagt, auch auf die Fragen kommen, die verborgen bleiben können, wenn man lediglich betrachtet oder hört.
Bevor er loslegte, hatte er das Mozart-Requiem bereits mehrmals selbst aufgeführt. Dabei waren ihm in der von Süßmayr komplettierten Fassung einige kompositionstechnische Ungereimtheiten aufgefallen. Vieles war offenbar nicht so geraten, wie es der Meister selbst komponiert hätte. Das ist nicht verwunderlich, denn Süßmayr stand beim Ergänzen unter Zeitdruck – und er war nicht Mozart.
Für seine Ergänzung studierte Michael Ostrzyga die Forschungsliteratur, unternahm umfassende vergleichende Stil- und Quellen-Studien, beschäftigte sich mit Mozarts Schaffensprozess und wertete die historischen Hinzufügungen aus der Zeit unmittelbar nach Mozarts Tod aus. Doch er näherte sich seiner Aufgabe nicht rein akademisch an. Die Musik ist für ihn »so tief, dass man sie überhaupt nicht vermessen kann«. Daher war ihm nicht nur das Handwerkszeug wichtig, sondern auch etwas, das schwerer zu greifen ist: die »Seele« der Musik.
Mozarts Kunst – Eine Zeitkapsel
Musikalische Detektivarbeit – den richtigen Ton treffen
Michael Ostrzyga ist nicht der erste, der sich eine Überarbeitung des Requiems wagt. Bekannte Komponisten Richard Strauss und Benjamin Britten, die auch Dirigenten waren, hatten bereits Änderungen an Süßmayrs Ergänzung vorgenommen. Auch Franz Liszt hat Klavier-Transkriptionen zweier Requiem-Sätze geschrieben, wobei er eine Reihe von Tonhöhen änderte. Zwei heute unbekannte Komponisten hatten schon im frühen 19. Jahrhundert einen zusätzlichen Satz zum Requiem komponiert. Dieser Satz gehörte liturgisch nicht zum in der Kirche gesungen Requiem, sondern wurde erst im Anschluss am Grabe vorgetragen. Tatsächlich ist eine der Vertonungen eines solchen Libera me, jene von Ignaz Ritter von Seyfried , bei der Grablegung Beethovens gesungen worden, nachdem zuvor die Süßmayr-Ergänzung von Mozarts Requiem in der Kirche erklungen war.
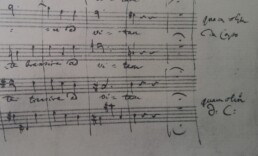

Ausschnitt der letzten Seite des Requiems, möglicherweise der letzten Notenseite, die Mozart in seinem Leben beschriftet hat. Die rechte untere Ecke war in früherer Zeit noch vorhanden. Sie wurde wahrscheinlich 1958 auf der Weltausstellung in Brüssel abgerissen und gestohlen.
Richtig zufrieden gegeben hatte sich die Musikwelt mit Süßmayrs Arbeit also nie. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich schon viele an der Aufgabe versucht, das Mozart-Requiem neu zu ergänzen – darunter Profis ebenso wie Amateure.
Ostrzyga kannte die bei Verlagen erschienenen Bearbeitungen und sah sich auch neuere Arbeiten genau an, bevor er seinen eigenen Versuch startete. Aber wäre ihm eine wirklich überzeugende Fassung untergekommen, hätte er vermutlich keine eigene Ergänzung erarbeitet. In den Begleittexten zu seiner Edition geht er genau auf Probleme früherer Fassungen aber auch stilistischer Einschätzungen im Forschungsdiskurs ein.
Mozarts Kunst – Musikalische Detektivarbeit
Den Ausführenden bleibt die Wahl
Michael Ostrzygas Requiem-Ergänzung wurde der Öffentlichkeit erstmals im Juli 2017 an der Harvard-Universität in den USA vorgestellt. Doch damit war seine Arbeit noch nicht abgeschlossen: Noch immer getrieben von Neugier – und auch noch nicht ganz überzeugt von seinen eigenen Ergebnissen – suchte er nach weiteren Hinweisen, hinterfragte seine Lösungen, verarbeitete Feedback und entwickelte seine Edition weiter.
Für wenige Sätze hat er schließlich zwei Varianten komponiert. Dirigent:innen können so zwischen Szenarien wählen, die sich gegenseitig aufgrund der Überlieferungslage nicht definitiv ausschließend lassen. Auch bei der Instrumentierung bietet er den Ausführenden für wenige Stellen aus seiner Sicht gleichermaßen naheliegende Optionen. Je nachdem, was ihrem Mozartbild entspricht, haben sie so einen gewissen Spielraum. »Das ist eine konsequente Folge der Geschichte dieser Musik, die aus der Feder eines einzigen Autors ja gar nicht existieren kann«, sagt Ostrzyga.
Im August 2019 präsentierten Chorwerk Ruhr und Concerto Köln unter Leitung von Florian Helgath Ostrzygas Vervollständigung beim renommierten Rheingau Musik Festival. Im Anschluss wurde sie auf CD eingespielt. Der Kölner Stadtanzeiger berichtete in einem großen Artikel. 2021 wurde diese CD als »Editorische Leistung des Jahres« für den Opus Klassik, einem bedeutenden deutschen Preis der Fach-Branche, nominiert. Im Juli 2022 erscheint die Notenausgabe beim traditionsreichen Musikverlag Bärenreiter mit umfangreichen Begleittexten.
Ostrzyga geht es, auch wenn er manche früher vorgestellte Lösung und Stileinschätzung kritisch hinterfragt, um einen konstruktiven Dialog. Er sieht seine Arbeit als Teil einer dynamischen Auseinandersetzung mit Mozarts Requiem, denn, wie er sagt, »was Mozart selbst geschrieben hätte, das werden wir nie wissen«.
Galerie
Bildnachweis: public domain via wikimedia commons (1) Unknown author, possibly by Pietro Antonio Lorenzoni (1721-1782) (2) School of Verona, attributed to Giambettino Cignaroli (Salo, Verona 1706-1770) (3) Johann Nepomuk della Croce (4) Barbara Krafft (5) Joseph Lange (6) International museum and library of music
Collegium musicum
Das Collegium musicum der Universität zu Köln gestaltet und repräsentiert unter der Leitung von Michael Ostrzyga das Musikleben der Universität zu Köln und bietet sowohl Studierenden und Angehörigen der Universität als auch externen Interessierten vielfältige Möglichkeiten, Musik zu erleben.
Die Ensembles umfassen vom großen Sinfonieorchester über kleine a cappella Besetzungen bis hin zu Jazzchor, Big Band und Kinderchor eine große Bandbreite. Das Programm reicht von den Bachschen Passionen bis hin zu Jazz-Standards, von Gesängen des Mittelalters bis zu Klängen des 21. Jahrhunderts, von der großen romantischen Sinfonie bis zum Liederabend.
Neue aktiv mitwirkende Musiker:innen in den Ensembles sind jederzeit ebenso willkommen wie neugierige Konzertbesucher:innen. Den aktuellen Bestimmungen gemäß ist eine Probenteilnahme im Moment nur vollständig geimpft oder genesen möglich (2G). Ein freiwilliger Selbsttest oder Bürgertest vor dem Probenbesuch wird dringend empfohlen.
Jedes Semester veranstaltet das Collegium musicum die UNIVERSITÄTSKONZERTE, eine abwechslungsreiche Konzertreihe, in deren Rahmen nicht nur die eigenen Ensembles auftreten, sondern auch eingeladene Künstler:innen und Ensembles als Gäste. Die Reihe wird zum Wintersemester 21/22 mit wenigen ausgewählten Terminen wieder starten. Ob die Konzerte wirklich mit Publikum stattfinden können, wird je nach aktueller Pandemie-Lage kurzfristig entschieden.
Im Sommersemester 2021 hat das Collegium musicum Stücke erarbeitet, die Eingang gefunden haben in ein online-Format zum Thema »Totentanz« (Videoclip), das am Totensonntag, 21. November 2021, Premiere hatte. Aktuelle Informationen über das Collegium musicum finden Sie hier .
Text:
Michael Ostrzyga,
Eva Schissler
Video:
Manoel Mahmd,
Adam Polczyk
Website Konzept, Technik, Gestaltung:
Anette Hartkopf
Digitale Lehre
Prorektorin Professorin Dr. Beatrix Busse
Prof. Dr. Markus Ogorek, StaatsorganisationsrechtMit einem Kung Fu Meister Physik lernen
Prof. Dr. André Bresges, PhysikdidaktikKlassenraum im Kopf
Prof. Dr. Peter Schilke, AstrochemieInternationaler Dauerbrenner: j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies
Anja Blode, Skandinavistik Individuelles Lernen in einer Großveranstaltung bei extrem diversen Vorkenntnissen
Dr. Christoph Scheicher, Mathematische MethodenAltertum goes digital: Studierende lernen online Latein
Fabian Neuwahl, Sebastian Neuwahl, Altertumskunde Palliativmedizin: Reden über existentielle Themen
Prof. Dr. Raymond Voltz, PalliativmedizinKorrektoren überzeugen – wie geht das?
Dr. Oliver Froitzheim, Bürgerliches RechtSpagat aus Wissensvermittlung und Anwendungsbezug
Michael Ehlscheid, Bildungswissenschaften
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Vorlesung „Staatsorganisationsrecht“
„Auch ohne Campus-Präsenz möglichst nahbar sein“
Zum ersten Mal haben die Studierenden der Fachschaft Jura und des Legal Tech Labs Cologne einen Sonderpreis für Digitale Lehre vergeben. Er ging an Prof. Markus Ogorek vom Institut für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre für sein Engagement im Sommersemester 2020. Seine Vorlesung „Staatsorganisationsrecht“ zeigt, wie komplexe juristische Themen digital erfolgreich vermittelt werden können und auch die Nähe zwischen Studierenden und Dozent erhalten bleibt.
Wer in Köln Jura studieren möchte, kommt um die Vorlesung mit dem etwas sperrigen Namen „Staatsrecht II: Staatsorganisationsrecht“ nicht herum. Nachdem alle Studierenden im ersten Semester wichtige Grundrechte wie z.B. die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung kennengelernt haben, geht es im zweiten Semester nun um die Organisation unseres Staates. Welche Verfassungsorgane gibt es? In welchem Verhältnis stehen Bundestag und Bundesregierung zueinander? Und welche Rolle spielen eigentlich die Bundesländer? Diese und viele weitere Fragen hat Markus Ogorek im Sommersemester 2020 beleuchtet und diskutiert.
„Sprödes“ Staatsorganisationsrecht – das Wesen unserer modernen Demokratie
„Staatsorganisationsrecht kann zunächst spröde und kompliziert wirken“, so der Jura-Professor. „Ob es die Zahl der Gesetzes-Lesungen im Bundestag oder die Geschäftsverteilung in der Bundesregierung betrifft, im Fokus stehen oft Zuständigkeiten, Form und Verfahren. Doch hinter diesen Regelungen verbirgt sich das Wesen unserer modernen Demokratie, die eine ausgewogene Verteilung staatlicher Macht erfordert. Zudem ist das Verfassungsrecht extrem praxisrelevant, es öffnet uns die Augen dafür, wo die Stärken und Schwächen unseres Staates liegen.“
Rund 500 Studierende waren für die mit fünf Semesterwochenstunden im Stundenplan veranschlagte Veranstaltung und nach Alphabet geteilte Veranstaltung registriert, die übrigen Kommilitonen besuchten eine Parallelveranstaltung. „Die Vorlesung ist für unsere Studierenden an sich schon eine echte Herausforderung“, so Markus Ogorek, „denn vieles ist für sie anfangs sehr abstrakt und nur schwer greifbar. Welche Vorlesungsteilnehmer haben schon Praxiserfahrung im politischen Berlin vorzuweisen?“

„Wie in fast allen Lebensbereich hat die Corona-Pandemie auch in unserem Lehralltag grundlegende Veränderungen mit sich gebracht“, fährt Ogorek fort. Statt in den großen Sälen des Hörsaalgebäudes fanden die Vorlesungen vollständig über das Videokonferenz-Tool Zoom statt.
Dies sei eine echte Herausforderung gewesen, so der Juraprofessor, weil er erst unlängst nach Köln berufen worden sei und deshalb zu Beginn der Vorlesung noch seine Amtsgeschäfte als Präsident der EBS Universität im hessischen Rheingau habe zu Ende führen müssen. „Digitale Lehrmittel haben wir dort schon früher eingesetzt. Als dann das Virus im März 2020 auch Deutschland erreichte und wir in den ersten Lockdown gingen, konnte ich von den Erfahrungen an meiner alten Wirkungsstätte enorm profitieren“, sagt Markus Ogorek. „Dennoch mussten wir im Grunde genommen alle Formate von jetzt auf gleich aus dem Hut zaubern, teilweise haben mein erster Kölner Mitarbeiter und ich sie in langen nächtlichen Telefonaten entwickelt und am nächsten Morgen direkt eingesetzt.“
„Wichtig war mir“, sagt Markus Ogorek, „auch ohne Campus-Präsenz möglichst nahbar zu sein. Außerdem wollten wir den Studierenden ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität ermöglichen und sie so gut es geht aktivieren.“ Alle Lehrveranstaltungen wurden zusätzlich aufgezeichnet und zu jeder Sitzung Kontrollfragen erstellt, mit denen die Teilnehmenden ihren Lernfortschritt selbstständig überprüfen konnten.
Über 900 PowerPoint-Folien und 33 Videoaufzeichnungen
Daneben boten Professor Ogorek und sein Institutsteam wiederholt Frage-Antwort-Sitzungen, regelmäßige (Einzel-)Sprechstunden, einen Lernfragen-Service per E-Mail sowie einen abschließenden Crashkurs an. Über 900 PowerPoint-Folien, 33 Videoaufzeichnungen mit einer Gesamtlänge von fast 40 Stunden, dazu 286 Kontrollfragen mit jeweils genauer Zeitangabe der Lösungen in den Mitschnitten, fünf Podcasts, sieben Prüfungsschemata, zwei Probeklausuren mitsamt Lösungen, 24 Leitentscheidungen, diverse Aufsätze, Gutachten und schließlich schriftliche Lösungen zu den besprochenen Fällen konnten die Studierenden jederzeit online abrufen.
„Im Zentrum“, sagt der Juraprofessor, „stand der Gedanke: Wir müssen alles tun, um den persönlichen Kontakt nicht abreißen lassen. Unser Anliegen war es, die Studierenden, die im ungünstigsten Fall den ganzen Tag in einem kleinen WG-Zimmer mit schlechtem Internet verbringen, nicht nur zu unterrichten, sondern sie auch zu motivieren und an unserer Begeisterung für das Fach teilhaben zu lassen.“ Die gute technische Ausstattung des Instituts sei dabei eine große Hilfe gewesen. Als sinnvoll für die Stoffvermittlung habe sich z.B. erwiesen, während der Zoom-Meetings mittels Tablets eine virtuelle Tafel zu beschreiben oder im Studierenden-System ILIAS übersichtlich gestaltete Seiten einzurichten.
Markus Ogorek betont: Die Umsetzung des Konzepts sei nur im Schulterschluss mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät möglich gewesen. So habe die Jura-IT bei technischen Fragen stets schnell und unkompliziert helfen können, das Prüfungsamt habe für die erfolgreiche Durchführung der Semester-Abschlussklausur gesorgt – „die übrigens zum ersten Mal überhaupt online gestellt wurde“, wie Ogorek bemerkt. Die Verleihung des Sonderpreises Digitale Lehre durch die Fachschaft Jura und das Legal Tech Lab Cologne sieht der Professor ganz klar als Teamleistung.
„Am Ende“, resümiert Markus Ogorek, „können technische Instrumente die Lehre ganz erheblich unterstützen. Entscheidend sind aber der persönliche Kontakt und der Respekt gegenüber den Studierenden. Allen Lehrenden kann ich aus unserer Erfahrung heraus nur empfehlen, aktiv auf die Studierenden zuzugehen. Eine gute Vorlesung ist ein Dialog zwischen dem Dozenten und den Teilnehmern. Im besten Fall sind am Ende nicht nur die Studierenden klüger, sondern auch ihr Professor. Online-Tools sind hier wichtige Begleiter und werden hoffentlich auch nach der Corona-Pandemie eine wichtige Rolle dabei spielen, für unterschiedliche Lerntypen maßgeschneiderte Angebote zu schaffen.
Dass wir auf unsere Vorlesungsangebote, die in Präsenz stattfinden, stolz sein können, ist da kein Widerspruch. Zukunftsweisend werden hybride Lehrmodelle sein, die den Bedürfnissen und Vorlieben unserer Studierenden, aber auch den unterschiedlichen Lebensentwürfen Rechnung tragen.“
 Univ.-Prof. Dr. iur. Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley)
Univ.-Prof. Dr. iur. Markus Ogorek, LL.M. (Berkeley)
Institut für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre
Markus.Ogorek@uni-koeln.de
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Physikdidaktik
Mit einem Kung Fu Meister Physik lernen
Professor Dr. André Bresges, Physikdidaktik, erzählt, wie die Erfahrungen mit populären YouTube-Wissenschaftsclips in seinen Kursen umgesetzt wurden.
Wie kann man Physik überhaupt in einem Hörsaal lernen? Schließlich ist Physik eine Naturwissenschaft und findet eher draußen in der Natur statt – oder in einer Laborumgebung, die sich bemüht Eigenschaften der natürlichen Umgebung so gut wie möglich zugänglich zu machen.
Der Hörsaal hat zunächst einmal nichts davon, er ist eine sehr künstliche Umgebung und wir Wissenschaftler*innen haben uns redlich bemüht, ein schwaches Abbild der Natur, oder unserer Labore, dorthin zu transportieren.
Nun sind wir mit einem Ruck im digitalen Zeitalter angekommen. Eine wesentliche (und manchmal verstörende) Leitfrage dabei war für uns: Warum gilt Physik in Schule und Hochschule eigentlich als ein unbeliebtes Fach, während auf YouTube Wissenschaftsvideos sich großer Beliebtheit erfreuen?
Immerhin betreiben zwei Absolventen aus unserem Hause, die Physik-Lehramtsstudenten Simon Wessel-Therhorn (“Lekkerwissen”) und Jacob Beautemps (“Breaking Lab“) gut laufende YouTube-Kanäle mit bis zu 270.000 Abonnenten. Etwas von dem, sie bei uns gelernt haben, funktioniert also und interessiert Menschen.
Was genau ist „es“? Ist die wissenschaftliche Fragestellung dahinter. Wie können wir „es“ in unsere Lehre einbringen? Ist die hochschuldidaktische Fragestellung.
Wir haben uns gemeinsam mit unserem YouTuber Jacob Beautemps als Doktorand auf die Reise zu machen und beide Fragen auch gemeinsam zu beantworten.
Den Ausgangspunkt bildete eine Befragung der Abonnent*innen typischer YouTube-Kanäle mit wissenschaftlichen Inhalten mit immerhin 5183 Teilnahmen. Das ist erstens ein Zeichen für die hohe Reichweite digitaler Kanäle, und zweitens dafür, dass diese Kanäle in beide Richtungen offen sind – sehr zum Vorteil der Universität.
Aus den Antworten wir 17 Regeln identifizieren, die für erfolgreiche YouTube-Kanäle gelten sollten. Diese sind publiziert in (Beautemps 2020, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2020.600595/abstract, angenommen) und vorab veröffentlicht unter: https://www.jacob-beautemps.de/so-geht-youtube/
Die Anwendung der 17 „YouTube-Regeln“ soll nach Aussage der Befragten ein Faktor dafür sein, dass ein YouTube Kanal erfolgreich wird. Dies konnten wir zum Glück sehr leicht testen. Der nachstehende Infograf (Beautemps 2020) zeigt die Aufrufzahlen des Testkanals „Breakin Lab“ vor und nach der konsequenten Anwendung der YouTube-Regeln ab Oktober 2019.
Wie können wir „es“ in unsere Lehre einbringen?
Die Übertragung auf die Hochschullehre ist nicht einfach – und führt schnell zu der Frage, was die Hochschullehre überhaupt auszeichnet, und von informaler Bildung abgrenzt. Spätestens hier ist es unerlässlich, die Studierenden einzubeziehen!
Das besondere an Universität ist nicht das Fachwissen – sondern das gemeinsame Wahrnehmen und Deuten von Phänomen. YouTube Videos sind kompakt, informativ und bringen sehr viel Kontext und interessante Expert*innen ins Spiel. Die gemeinsame Interaktion ersetzen sie nicht.
Das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen haben wir mit der Lehrveranstaltung „Experimentalphysik 1“ im Wintersemester 2020/2021 mit 311 Teilnehmer*innen ausgiebig erprobt.
Grundstock bieten die Vorlesungsvideos, die jede Woche passend zur Vorlesung auf einem YouTube-Kanal bereitgestellt werden (https://www.youtube.com/c/AndréBresgesCologne). Einer der YouTube-Regeln besagt, dass das ideale Video zwischen 7 und 11 Minuten, auf keinen Fall aber länger als 15 Minuten sein sollte. Das hört sich, gemessen an der typischen Vorlesungslänge von 90 Minuten, nach nicht viel an. Aber, wer kann denn 90 Minuten lang mit vollem Tempo durchreden?
Ich habe jedenfalls festgestellt, dass ich mit vollem Tempo 10 Minuten durchreden kann. Spricht man in dieser Dichte, ist dies noch zu lang. Jeder Film wurde daher in 3 Inhaltliche Blöcke unterteilt. Diese gaben auch die Einteilung der synchronen Lehrveranstaltung in Zoom vor. Die Studierenden sahen zum Einstieg, zur Mitte und zum Abschluss der Vorlesung jeweils einen Block von 3-5 Minuten Länge, und hatten die doppelte Zeit dafür zur Verfügung. Sie konnten also anhalten, sacken lassen, nachschlagen, einzelne Stellen oder den ganzen Abschnitt noch einmal schauen.
Für die Strukturierung der Vorlesungssitzung wurde die Software MURAL genutzt. Jedes MURAL, für jede Sitzung, hatte die gleiche Struktur (Beispiel)
Die linke Seite (blau) bildet immer die Arbeitsfläche des Lehrenden – hier gibt es Links die direkt in den passenden Abschnitt des YouTube Videos führen, Screenshots und Folien aus diesem Teil des Films zum Nachschauen und bearbeiten, Literaturverweise und Links auf Computersimulationen (https://phet.colorado.edu) mit denen die Vorlesungsinhalte nachgestellt und nachbearbeitet werden können. Auf urheberrechtlich geschützte Materialien wurde verlinkt, um die Autorenrechte nicht zu verletzen.
Die rechte Seite bildet die Arbeitsfläche der Studierenden in MURAL. In der Regel wurde jede Vorlesung mit 3 Breakout Rooms von etwa 15 Minuten Länge zeitlich strukturiert. Die Studierenden waren einer „Farbe“ zugeordnet und fanden sich immer wieder in dem gleichnamigen Breakout Room zusammen. Sie hatten dort Zugriff auf eine von 6 Kopien des MURALs, in der gleichnamigen Farbe. Studentische Hilfskräfte sorgten Eingangs der Vorlesung für die Verteilung der MURAL in den Breakout Rooms und brachten die Diskussion in Gang. Bewährt hat sich eine Aufteilung von 10 Minuten Filmbeitrag, 15 Minuten Bearbeitung im Breakout Room und 5 Minuten Präsentation der Ergebnisse aus den MURALs, bevor es in den nächsten Block von 30 Minuten ging.
Im weiteren Verlauf des Semesters wurde aber alles sehr schnell zur Routine; der immer gleiche zeitliche Rhythmus der Vorlesung und die einheitliche Gestaltung der MURALs sorgte für Orientierung und entlastete die Teilnehmer für den Blick auf das Wesentliche.
Einbindung von Experten
Eine wichtige YouTube – Regel, auf die wir durch unsere Forschung gestoßen sind: Lernende schätzen es sehr, wenn etwa 25% eines Videos mit einem Expertengespräch zum Thema gefüllt ist. Aber sie mögen es auch, wenn die Aussagen der Experten von der Dozent*in noch einmal „klausurrelevant“ zusammengefasst werden.
Deswegen hatten wir regelmäßige Zoom-Konferenzen mit dem Fachleiter für Physik am ZfSL Leverkusen, denen wir die ersten Versionen der Filme regelmäßig vorstellten, und ihn dabei um einen Hinweis zum Einsatz der fachwissenschaftlichen Inhalte im Unterricht baten. Mit seinem Einverständnis konnten wir diese Hinweise direkt in Zoom aufzeichnen und in die Lehrfilme einarbeiten.
Es lohnt sich für eine Vorlesung, die jährlich wiederholt wird, einmal einen ganzen Drehtag zu investieren, um einen Experten direkt an seinem Arbeitsplatz zu besuchen: Einen Großmeister des chinesischen Wing Tsjun Kung Fu, Thommy Luke Böhlig, in seiner Trainings-Akademie in Langenfeld. Mit einem Smartphone konnten wir die von ihm (an uns) demonstrierten Griffe und Stöße aufzeichnen und ihre Entschlüsselung als Aufgabe an die Studierenden in den Breakout Rooms geben.
Mit der Vorbereitung aus den ersten Teilen des jeweiligen Erklärvideos war es den Studierenden im zweiten Breakout Room möglich, die „umwerfenden“ Effekte auf Prinzipien der klassischen Mechanik wie Impulserhaltung, Hebelwirkung und Brückenbau zurückzuführen. Mit digitalen Medien gelang es so, Einblicke in die Hochschule zu bringen die dem normalerweise spröden Thema einen ganz anderen Kontext gegeben haben. In den Breakout Rooms ging es auch durchaus sportlich zu, wie wir bei unseren Besuchen gesehen haben – die Studierenden haben aus ihren Wohngemeinschaften oder Elternhäusern rekrutiert wer gerade zu Hause war, um die ebenso ungefährlichen wie unglaublichen Befreiungstechniken nachzuvollziehen.
Im Verlauf der Vorlesung stiegen, durchaus ungewöhnlich, sowohl die Teilnehmerzahlen als auch die Anzahl der Zugriffe auf die Videos, bis zu einem Spitzenwert von 750 Zugriffen auf dieses Video: https://youtu.be/mrLyj6AtTBY?t=225
Institut für Physikdidaktik
Andre.Bresges@uni-koeln.de
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Astrochemie
Klassenraum auf dem Kopf
Das Entstehen und Vergehen von Molekülen und Staub im Weltraum zu erforschen ist Aufgabe der Astrochemie und sicherlich keine einfache Materie. Wie schafft man es, sie in einer Spezialvorlesung den etwa 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Masters Physik auch noch digital näherzubringen? Professor Dr. Peter Schilke von der Arbeitsgruppe Astrophysik hat eine erfolgreiche Methode gefunden.
Schon länger hatte sich der Astrochemiker mit der Unterrichtsmethode des Inverted Classroom-Konzepts beschäftigt. In diesem „umgedrehten Unterricht“ eignen sich die Studierenden die Inhalte zu Hause eigenständig an, die von den Lehrenden digital zur Verfügung gestellt wurden. Die Präsenzveranstaltung wird dann zur gemeinsamen Vertiefung des Gelernten genutzt. Das Problem dabei: Was, wenn die Studierenden zur Diskussion aufgefordert würden und dann alle betreten nach unten schauen, und niemand was sagt?
Ein didaktisches Konzept aus Harvard kam dem Astrochemiker zur Hilfe: Als Peter Schilke von einem weiteren Konzept, der Peer Instruction des amerikanischen Physikers Eric Mazur hörte, machte er sich daran, gemeinsam mit weiteren Kollegen aus dem Institut, Dr. Alvaro Sanchez-Monge und Dr. Sven Thorwirth, Vorlesungen und Übungen zu entwickeln und startete erfolgreich im Sommersemester 2019 mit der Umsetzung dieses Konzepts – damals natürlich noch als Präsenzveranstaltungen.
Die Grundidee des Peer Instruction-Konzepts liegt in der gegenseitigen Interaktion der Studierenden. So sollen z.B. nach einem kurzen Einführungsreferat Fragen per Multiple Choice beantwortet werden. Im Anschluss sollen die Studierenden ihren Kommiliton*innen ihre Wahl begründen.
Arbeiten in Gruppen und gemeinsame Diskussion
Mit dem Umstieg auf die digitale Lehre im Sommersemester 2020 wurde die Vorlesung nun im komplett digitalen Inverted Classroom-Format durchgeführt. In ca. 10-Minuten-Stücken wurden die Vorlesungsvideos aufgenommen und über ILIAS zur Verfügung gestellt. Diese Vorlesungen, und eventuell weitere Materialien, sollten von den Studierenden vor der live geschalteten Kontaktzeit (im Vorlesungsslot, über Zoom) angeschaut werden. In der Kontaktzeit wurde den Studierenden Gelegenheit zu Fragen zu den Videos gegeben. Anschließend wurden vertiefende Fragen gestellt.
MURAL ist ein browser-basiertes digitales Whiteboard, auf dem alle Teilnehmer*innen interagieren können, z.B. Strukturen erstellen und diskutieren.
„Am Anfang haben wir dazu die ILIAS Live Voting Funktion benutzt, entweder mit Multiple Choice oder auch Ordnungs- oder Zuordnungsfragen. In der zweiten Hälfte der Vorlesung sind wir dann zum Echtzeit-Whiteboard MURAL übergeschwenkt“, erklärt Professor Schilke.
„Entweder nach dem Live Voting oder sofort, wenn wir MURAL benutzt haben, wurden die Studierenden in Zoom Breakout Rooms geschickt, mit ungefähr 5 Teilnehmer*innen. Die Gruppen wurden bei jeder Vorlesung neu gemischt. Dort hatten sie 10-15 Minuten Zeit, entweder die Fragen zu diskutieren (Peer Instruction) oder die MURALs zu bearbeiten. Jeder Breakout Room hatte ein eigenes MURAL. Nach dieser Zeit sind wir wieder zusammengekommen und haben die Ergebnisse gemeinsam diskutiert. Am Ende jeder Vorlesung gab es eine kurze Feedback-Runde, die ebenfalls in ILIAS stattfand. „ Im vorherigen Semester hatten wir das als zweidimensionale Matrix ausgelegt, wo die Vorlesung in den Koordinaten Nützlichkeit und Schwierigkeit bewertet werden sollte, in ILIAS ging das nicht“, so Schilke.

Übungen: Fragen finden und beantworten
Die Übungen waren, ebenfalls in Gruppen, als Projektarbeit angelegt. Es gab verschiedene Felder aus der Vorlesung (z.B. Chemistry of star formation, reactions and rate coefficients).
Die Studierenden sollten in einem erste Schritt offene Fragen in dem Gebiet identifizieren, sich im zweiten Schritt überlegen, wie die offene Frage beantwortet werden könnte (d.h. welche Beobachtungen oder Experimente dazu nötig sind), und im dritten Schritt Frage, Lösungsansätze und konkrete Vorschläge (die sehr weit gefasst werden konnten, von „ich muss 2 Stunden Beobachtungszeit an einem Observatorium beantragen“ bis zu „ich muss ein Weltraum-Interferometer im Ferninfraroten für 10 Milliarden Euro bauen“) in einer Präsentation vorstellen.
„Da sind viele Ideen aufgetaucht, die mir nie gekommen wären.“
„Mir hat die Veranstaltung gut gefallen, weil durch dieses Format alle Studierenden aktiv teilgenommen haben“, so Prof. Schilke. Da die Dozenten, außer bei Nachfragen, in den Breakout Rooms nicht anwesend waren, war die Hemmschwelle, etwas zu sagen, kleiner. Positiv fand er auch, dass die Teilnehmer der Breakout Rooms jedes Mal neu zusammengestellt wurden, so dass sich kein „group thinking“ einschleichen konnte. „Das war im Jahr vorher, in Präsenz, nicht so, da sich dort immer die gleichen Grüppchen zusammengefunden hatten“.
Im Laufe der Zeit habe sich die Hemmung gelegt, vor allen etwas zu sagen, die Ergebnisse aus den Breakout Rooms zu präsentieren, oder in großer Runde während der Kontaktzeit mitzudiskutieren. Auch die Projektarbeit für die Übungen fand Prof. Schilke sehr spannend: „Da sind viele Ideen aufgetaucht, die mir nie gekommen wären.“
Die Vorlesungsvideos und Übungen wurden zunächst am heimischen Laptop erstellt. „Der Aufwand,“ so Prof. Schilke, „war etwas höher als für die Vorlesung, da neben der Vorbereitung auf die Vorlesung selbst und den Aufnahmen und Bearbeitung der Videos auch die Fragen zur Kontaktzeit erstellt werden mussten, und dann natürlich die Kontaktzeit selbst“.
Am schwierigsten fand er, die Fragen bzw. MURAL-Aufgaben so zu konzipieren, dass sie weder zu trivial noch zu komplex sind. Wichtig war auch, die Studierenden über die reine Rekapitulation der Vorlesung heraus zum Denken zu animieren.
Künftig nur kleinere Änderungen
Prof. Schilke würde an seinem Konzept eigentlich nur kleinere Details ändern wie z.B. kleinere inhaltliche Umgestaltungen. Auch einige Fragen in ILIAS und Aufgaben in MURAL könne man sicherlich noch besser formulieren. Insgesamt sieht er seine Erfahrungen aber positiv: „Ich hätte mich schon viel früher trauen sollen, dieses Konzept zu implementieren. Wir haben offen mit den Studierenden kommuniziert und gesagt, dass das Konzept sehr experimentell ist und wahrscheinlich einige Wiederholungen braucht, um einigermaßen zu funktionieren. Das ist auch auf viel Verständnis gestoßen, und mit dem vielen, konstruktiven und direkten Feedback, das wir bekommen haben, sind wir dann auch relativ schnell konvergiert.“
Dass das Konzept von Professor Schilke gut ankommt, zeigt die Reaktion der Studierenden: Für seine Vorlesung erhielten er und sein Team den Albertus-Magnus Lehrpreis in Physik.
Institut für Astrophysik
schilke@ph1.uni-koeln.de
Philosophische Fakultät, e-Master Skandinavistik
Internationaler Dauerbrenner: j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies
Best-Practice, national und international vernetzt und das seit 2013: Die digitalen Veranstaltungen von j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies haben schon früh den Weg zur digitalen Lehre gewiesen. Im WS 2019/20 z.B. war es ein digitales Seminar über Wikinger und das nordische Mittelalter, das über ILIAS und mit Werkzeugen wie dem One Button Record Studio, h5p, Blogs und Chats die Möglichkeiten ausschöpfte.
 „Wikinger sind zurzeit irgendwie ‚angesagt‘“, resümiert Anja Blode vom Institut für Skandinavistik/Fennistik. Im Fernsehen und im Web treiben die alten Nordmänner ihr Unwesen, mal historisch akkurat, öfters mal weniger. Das Online-Seminar „Scandinavia in the Middle Ages (Wintersemester 2019/2020)“ von Blode war wohl auch wegen des medialen Hypes populär bei den Studierenden.
„Wikinger sind zurzeit irgendwie ‚angesagt‘“, resümiert Anja Blode vom Institut für Skandinavistik/Fennistik. Im Fernsehen und im Web treiben die alten Nordmänner ihr Unwesen, mal historisch akkurat, öfters mal weniger. Das Online-Seminar „Scandinavia in the Middle Ages (Wintersemester 2019/2020)“ von Blode war wohl auch wegen des medialen Hypes populär bei den Studierenden.
Insgesamt 11 Studierende, darunter acht aus Finnland und Frankreich nahmen daran teil – ein großer Erfolg für das kleine Fach Skandinavistik/Fennistik. Doch eigentlich ist das nichts Neues, findet Blode, die Mediävistin ist: „j o l n e s – Joint Learning in Northern European Studies läuft schon seit 2013 (damals noch als E-Master Skandinavistik und Fennistik). Von Anfang anbieten wir internationale kollaborative Seminare an.“ j o l n e s ist ein erfolgreicher Dauerbrenner der digitalen Lehre in Köln und in ganz Europa, 270 Studierende haben bisher an den Veranstaltungen teilgenommen, die von einem Kooperationsnetzwerk deutscher und europäischer Hochschulen angeboten werden. In Köln liegt dabei die technische Umsetzung des Kooperationsnetzwerks, das unter den Kolleginnen und Kollegen der sogenannten kleinen Fächer als Best-Practice-Beispiel gehandelt wird. Im Sommersemester werden sogar zwei Kurse angeboten werden, die im Rahmen des DAAD-Projekts EduVenture Cologne (IVAC) gefördert und angeboten.
Vielfältige Technik und Werkzeuge von ILIAS
Das digitale Seminar im Wintersemester 2019/20 richtete sich an Master- und fortgeschrittene Bachelorstudierende und sollte die Möglichkeit bieten, über verschiedene Themen der Wikingerzeit und des skandinavischen Mittelalters kritisch zu diskutieren, Forschungskontroversen aufzuzeigen und den Studierenden Zeit geben, ein selbstgewähltes Thema zu bearbeiten. So wurde es möglich, eine 90 Minuten Sitzung in viele kürzere, unterschiedlich gestaltete, Blöcke aufzuteilen und verschiedene Arbeitsmethoden einzubringen. Die Studierenden sollten selbstständig arbeiten und dabei selber digitale Kompetenzen erwerben. Zudem sollten die Referatsgruppen möglichst international besetzt sein, damit hier verschiedene Diskussionskulturen aufeinandertreffen.
Zwei Stunden pro Woche wurde digital zusammengearbeitet, erklärt Blode: „Es gab ein Videomeeting, in dem gemeinsame Inhalte erarbeitet, aber auch Hausaufgaben besprochen wurden. Ich hielt kurze Vorträge und beantwortete Fragen; dazu wurde im One Button Record Studio ein Video (30 Minuten) gedreht, das von den Studierenden bearbeitet werden musste. In den Meetings selber gab es Präsentationen sowie kurze Arbeitsphasen mit anschließender Diskussion.“
ILIAS diente als Zugangsvoraussetzung; hier wurden alle Dateien und Informationen zur Verfügung gestellt. Genutzt wurden Etherpads, Blog, Chat, interaktive Videos, Weblinks und die Angebote von h5p. Zudem wurde die in ILIAS implementierte Schnittstelle zu h5p genutzt, damit die Studierenden die Tools für die Präsentationen ihrer Ergebnisse nutzen konnten. In ILIAS gab es auch für die einzelnen Referatsgruppen Meetingräume bzw. gemeinsame Etherpads und Blogs, damit sie sich jederzeit treffen und den anderen Kommiliton*innen Informationen zur Verfügung stellen konnten. „Bis auf die persönliche Kommunikation, z.B. in den Online-Sprechstunden, lief alles über ILIAS“, erinnert sich Anja Blode. „Es ist sehr schade, dass ILIAS häufig nur als Dateiablage genutzt wird und die zur Verfügung stehenden Tools ungenutzt bleiben. Das versuchen wir im Projekt zu ändern. Ohne Zugang zu ILIAS sind die Kurse nicht möglich, da alles über die Plattform läuft und so auch die externen Studierenden Zugriff auf alles haben.“
Essen wie die Wikinger
Die Prüfung bestand aus einer Präsentation, die in einer Videokonferenz gehalten werden musste. Vorab wurden die Ergebnisse der einzelnen Referatsgruppen in einer Datei (unterschiedliche Formate) festgehalten und wurden allen anderen zur Verfügung gestellt.
Die französische Studierendengruppe hatte das Thema „Essen in der Wikingerzeit“ gewählt und traf sich zum gemeinsamen Kochen. Einige der Gerichte wurden dann sogar in das eigene Weihnachtsmenü integriert. Dazu entstanden ein Podcast und eine Homepage.
Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit Frauen aus der altnordischen Literatur. Sie erstellten selber Videos mit Voice Over.
„Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich selber auf ein Thema, das man noch nie zuvor in einem Kurs gegeben hat, einzulassen. Dazu kamen die spannenden Themen der Referatsgruppen, in die man sich teilweise auch erst einarbeiten musste“, fasst Blode zusammen. „Zudem merkte man, dass die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Ländern und Instituten kamen. Sie brachten teilweise vollkommen verschiedene Diskussionskulturen mit, die das Seminar sehr bereicherten.“
Auf Besonderheiten der digitalen Lehre achten
Auf einige Besonderheiten der digitalen Lehre will Blode beim nächsten Mal besonders Acht geben. So hatte sie den Studierenden einen eigenen Zeitraum zum Erstellen der Videos eingeräumt. „Das lief nicht so gut. Einige Videos wurden dann in der Zeit nicht erstellt.“
Es gab auch Aspekte der digitalen Veranstaltung, die mühsamer als die Präsenzlehre waren, findet sie: „In der persönlichen Kommunikation bzw. Präsenzlehre kann man manches schneller klären. Online-Veranstaltungen müssen von Anfang an besonders kleinschrittig bzw. detailliert vorbereitet und den Studierenden müssen viele Informationen an die Hand gegeben werden.“ Die Vorbereitung einer einzelnen Sitzung dauerte am Anfang fast doppelt so lange, bis die nötige Routine da war, zumal es sich hierbei um meinen ersten Online-Kurs handelte. Zudem musste manche Technik vorher erst erprobt werden. „Man sollte nicht darauf vertrauen, dass sich Studierende automatisch im digitalen Raum zurechtfinden bzw. sich mit der Technik auskennen.“, so die Wissenschaftlerin.
„Zudem würde ich den Studierenden von Anfang an mehr Tools zur Gruppenarbeit an die Hand geben.“, ergänzt sie. „Trotz WhatsApp etc. schienen die Studierenden ein gemeinsames Etherpad oder einen Blog zu bevorzugen, auch gemeinsame permanent offene Online-Meeting-Räume wurden gewünscht. Die Interaktion von Studierenden untereinander sollte noch stärker gefördert und vielleicht am Anfang auch forciert werden.“
Die Resonanz ist sehr gut
„Das Thema war natürlich für viele sehr reizvoll. Den Studierenden gefiel besonders, dass die einzelnen Sitzungen mit Aufgaben vorbereitet werden mussten, die dann in der Sitzung besprochen wurden“, erklärt die Mediävistin. Jede Sitzung wurde in verschiedene Teile aufgeteilt, Hausaufgaben wurden besprochen, es gab einen Impulsvortrag der Dozentin, Fragen zum Impulsvortrag wurden gestellt und diskutiert, es gab kleinere Aufgaben, die alleine oder zusammen während der Sitzung bearbeitet wurden. So entstanden jeweils kleine Blöcke und die Aufmerksamkeit wurde stets neu gefordert.
Unterschiedlicher Meinung waren die Studierenden allerdings, ob die verlangte „kreative“ Präsentation gut war oder nicht. „Manche waren total begeistert, andere hätten sich bei einer „normalen“ Powerpoint-Präsentation mit Vortrag wohler gefühlt“, erinnert sich die Skandinavistin.
Ein definitiver Vorteil bestand jedoch darin, dass in einem internationalen Umfeld diskutiert wurde und man eindeutig die unterschiedlichen Diskussionskulturen der einzelnen Länder wahrnehmen konnten, so Blode. „Es entstanden lebhafte Diskussion, die sich teilweise aus anfänglich harmlosen Fragen entwickelten.“
Gut fanden die Teilnehmer auch, dass den meisten Referatsgruppen ein eigener Arbeitsraum in ILIAS eingeräumt wurde. Dort konnten sie sich treffen, ohne dass jemand anderes Zugang hatte, erklärt die Wissenschaftlerin. „Dieses Angebot wurde tatsächlich stark genutzt und so konnten sie sich, länderübergreifend, austauschen. Viele freute es auch, dass sie mit anderen Studierenden aus dem Ausland arbeiten durften.“
„I like that so many students from different universities, with different backgrounds and different approach to reading and studying literature can meet within online courses.“
Viola Parente-Čapková, Associate Professor/ Docent in Theory of Literature, University of Turku
Anja Blode ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis der eigenen Lehrveranstaltung, aber auch mit dem übrigen Angebot von j o l n e s: „Das Angebot unserer Veranstaltungen wird inzwischen sehr gut angenommen. Die Teilnehmendenzahlen sind konstant und es stellt sich heraus, dass die Kurse die Präsenzlehre ergänzen und nicht etwa in Konkurrenz zu ihnen stehen. Zudem bieten wir Einblicke in die Themenschwerpunkte der anderen Institute und können so ein abwechslungsreiches Angebot bieten.“
 Anja Blode
Anja Blode
Institut für Skandinavistik/Fennistik
anja.blode@uni-koeln.de
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Mathematische Methoden
Individuelles Lernen in einer Großveranstaltung bei extrem diversen Vorkenntnissen
Das Basismodul „Mathematische Methoden“ müssen alle BWL- und VWL-Bachelor-Studierenden absolvieren. Entsprechend viele besuchen die Vorlesung, haben ganz unterschiedliche mathematische Kenntnisse und müssen auch individuell betreut werden. Und das alles digital. Geht das? Geht, viel besser als man denkt – sagt Dr. Christoph Scheicher vom Institut für Ökonometrie und Statistik.
Es gibt Vorlesungen, in denen alle Studierenden auf demselben Niveau beginnen. Das ist bei Mathe nicht der Fall. Zwölf oder dreizehn Jahre Schulmathe führen zu extrem unterschiedlichen Vorkenntnissen der Student*innen. Auch ist Mathe ein mehr oder minder beliebtes Pflichtmodul im BWL- und VWL-Studium. Wie kann man den unterschiedlichen Bedürfnissen bei einer großen Massenveranstaltung von teilweise über 1000 Teilnehmer*innen pro Semester im digitalen Lehrformat gerecht werden?
Dazu hat Christoph Scheicher sich an der Idee des Inverted Classrooms orientiert, Vorlesungsvideos produziert und gemeinsam mit Kolleg*innen E-Hausaufgaben erstellt. Hierzu hatten ihm die Workshops am Zentrum für Hochschuldidaktik viele hilfreiche Impulse gegeben. Die Videos wurden im One Button Recording Studio des Netzwerk Medien aufgenommen.
Diskussion statt Monolog
Die Student*innen erarbeiten sich die Inhalte zunächst größtenteils selbständig mit Hilfe der Videos oder einem Lehrbuch. „So kann man dann die Zeit im Hörsaal besser nutzen, indem man nicht ‚vorliest‘, also einen Monolog zu neuen Inhalten hält, sondern über die bereits erarbeiteten Inhalte diskutiert und diese vertieft“, so der Wirtschaftsmathematiker. Ein weiterer Vorteil sei hierbei natürlich, dass die Student*innen die Inhalte in ihrem individuellen Lerntempo erarbeiten können.
Nach einem Video zu einer Problemstellung und Definition folgt ein Video mit einem Satz oder einer Methode, um das Problem zu lösen, anschließend ein Video mit einem ersten, sehr leicht zu rechnenden Beispiel. Komplexere Beispiele werden dann in den E-Hausaufgaben und den Übungsstunden bearbeitet.
Vorlesung in kleinen Häppchen
Die Vorlesungen selbst sind in kurze Einheiten aufgeteilt. „Wenn ich mich selbst an meine Zeit als Student zurückerinnere, fand ich es schwierig einer neunzigminütigen Vorlesung mit gleichbleibender Aufmerksamkeit zu folgen. Darum habe ich die Vorlesung in viele kleine, leichter verdauliche Stücke von jeweils ein paar Minuten zerlegt.“
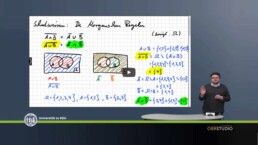
Auf der Lernplattform ILIAS bearbeiten die Studierenden dann E-Hausaufgaben, entstanden aus dem Projekt „Individuelle E-Hausaufgaben mit sofortigem Feedback“ mit Kolleg*innen und dem CompetenceCenter E-Learning (CCE). Für mathematische Aufgaben werden dabei spezielle Aufgabentypen verwendet, damit alle Student*innen unterschiedliche Aufgaben bekommen, deren Lösungen automatisch vom System berechnet, mit den Antworten der Student*innen verglichen und so umgehend individuelle Feedbacks erzeugt werden.
Die Studierenden können in interaktiven Übungen über Zoom die Themen anhand komplexerer Aufgaben vertiefen und schließlich mit alten Klausuraufgaben abschließen.
Breakout Room statt Sitznachbar
Sicherlich ist im Digitalunterricht einiges schwieriger, als im Präsenzunterricht. „Alle während der Vorlesung oder der Übungen mitmachen zu lassen, geht im Hörsaal natürlich etwas besser“, sagt Christoph Scheicher. „Ich habe den Studierenden sonst öfters mal Aufgaben zu lösen gegeben, die ihre Sitznachbar*in dann korrigieren sollte. Das geht online natürlich nicht.“ Dafür gebe es aber digitale Breakout-Rooms, in denen die Teilnehmer*innen in kleine Gruppen aufgeteilt arbeiten können.
Momentan stört es ihn am meisten, dass er statt Student*innen hauptsächlich schwarze Kacheln in den Übungen per Videokonferenz sehe. „Hoffentlich ist es mittelfristig möglich, dass durch bessere technische Ausstattung mehr Student*innen als bisher die Möglichkeit haben per Video an den Veranstaltungen teilzunehmen und sich so die Lernkultur weiter verbessern kann.“
Hürden gesenkt
Nicht jeder lernt gleich schnell und versteht die Aufgaben auf Anhieb. Deshalb gibt es für Studierende mit besonderem Bedarf zusätzlich kleine Tutoriumsgruppen zusammen mit Kommiliton*innen im höheren Semester, in denen geübt werden kann.
Außerdem hat Dr. Scheicher Fragestunden eingerichtet, in denen Fragen beantwortet und individuelle Probleme besprochen werden können.
„Im Sommersemester habe ich eine Sprechstunde angeboten, an der nur sehr wenige Studierende teilgenommen haben.“ Durch eine Umbenennung in „Fragestunde“ und zeitliche Verschiebung auf den wöchentlichen Termin, an dem die Vorlesung als Webinar zu Beginn, zur Mitte und zum Ende des Semesters stattfindet, ist diese Fragestunde jetzt stark frequentiert. „Die Hürde ist in diesen F+A Webinaren offenbar geringer, als zu mir in die individuelle Sprechstunde zu kommen. Ich werde in diesen eineinhalb Stunden i.d.R. durchgehend befragt.“
Mathe ist jetzt das Lieblingsfach
Das alles zahlt sich aus: Die Reaktionen der Studierenden sind überwiegend positiv, stellt Christoph Scheicher fest. „Natürlich kann man es bei einem Kurs mit mehreren Hundert Teilnehmern nie allen recht machen, insbesondere in einem Pflichtkurs im Bachelor, aber wenn man dann in offenen Fragebögen weit mehr positive als negative Feedbacks bekommt, z.B. wenn jemand schreibt, dass Mathe jetzt das Lieblingsfach sei, freut mich das natürlich sehr.“
Institut für Ökonometrie und Statistik
scheicher@statistik.uni-koeln.de
Philosophische Fakultät Fakultät, Latein
Altertum goes digital: Studierende lernen online Latein
Von manchem wurde Latein schon tot geglaubt: Doch wie aktuell und lebendig die Vermittlung der lateinischen Sprache sein kann, zeigt das Institut für Altertumskunde mit seinem digitalen Lehrkonzept. Neben dem Wälzen von Lehrbüchern können Kölner Studierende sich nun online in die wunderbare Welt des Ablativus absolutus und des AcI begeben.
Die Dozenten Fabian und Sebastian Neuwahl vom Institut für Altertumskunde betraten im digitalen Sommersemester 2020 die „terra nova“: Lateinunterricht online. Dabei sollte die digitale Umsetzung eine sinnvolle Ergänzung der analogen Konzeption sein – so ihre Prämisse.
Nach kurzer Vorbereitung entstanden ein e-Tutorium für Erstsemester und ein hybrides Lehr-/Lernformat in den deutsch-lateinischen Repetitorien.
Das e-Tutorium für Lateinerstsemester
Während des ersten Lockdowns im März 2020 wurde der Erstsemestervorkurs, das Propädeutikum, von einer Präsenzveranstaltung in ein e-Tutorium umgewandelt.
Die Tutorinnen und Tutoren entwarfen gemeinsam mit dem betreuenden Dozenten ein modular aufgebautes digitales Angebot, das in zwei Wochen die gesamte Schulgrammatik wiederholt und die Erstsemesterstudierenden anhand von Übungen auf den Eingangstest zum ersten Fachsemester Latein vorbereitet.
Dazu erstellten sie ein zeitlich versetztes Lehr- und Lernformat in Form von PowerPoint-Präsentationen mit Voice-Over-Kommentaren. Diese Inhalte wurden auf einer Cloud-Plattform zur Verfügung gestellt, da die Studierenden zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zugriff auf die ILIAS-Plattform hatten.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des e-Tutoriums konnten sich diese Inhalte zeitlich unabhängig erarbeiten und ergänzende Übungen bearbeiten, die in digitaler Form zur Verfügung gestellt wurden.
Ein Vorteil bei einem solchen asynchronen Vorgehen ist das hohe Maß an Flexibilität und Individualität bei der Planung des eigenen Lernprozesses. Das meldeten die Studierenden bei der internen Evaluation auch mehrfach lobend zurück.
Neben regelmäßigen Koordinations- und Reflexionstreffen der Tutorinnen und Tutoren trugen somit auch die Teilnehmenden durch ihre Rückmeldungen dazu bei, das e-Tutorium immer weiter zu verbessern.
Dennoch erkannten die Tutoren und Tutorinnen auch die Grenzen eines rein asynchronen Formats: Um den Nachteil der fehlenden direkten Interaktionsmöglichkeit auszugleichen, waren sie während des e-Tutoriums immer für Rückfragen per Mail erreichbar – was die Teilnehmenden auch vielfach in Anspruch nahmen.
Für eine weitere Durchführung des e-Tutoriums sind in Zukunft sogenannte Checkpoints eingeplant – festgelegte Stellen in der Erarbeitung des Lernstoffs, an denen die Erstsemesterstudierenden den Tutorinnen und Tutoren synchron Fragen stellen können.
Hybrides Lehr- und Lernformat in den deutsch-lateinischen Repetitorien
Entsprechend dem Inverted Classroom-Modell, dem umgedrehten Klassenzimmer, hat das Institut für die deutsch-lateinischen Repetitorien ein hybrides Format aus asynchroner und synchroner Lehre entwickelt.
Für die rein digitalen Repetitorien bedeutet das, dass die Studierenden die grammatikalischen Inhalte anhand zur Verfügung gestellter Materialien selbständig erarbeiten. Die gemeinsame digitale Sitzung dient der Vertiefung und Diskussion in „Breakout-Räumen“ und im Plenum.
Die Diskussionsgrundlage bilden Übungssätze, die über das digitale Whiteboard MURAL oder Cloud-Dienste zur gemeinsamen Bearbeitung freigegeben werden. Im Anschluss an die Sitzung können sich die Studierenden mithilfe von Tests, die von den Tutoren und Tutorinnen erstellt wurden, auf ILIAS selbst überprüfen und auf die Modulabschlussprüfung vorbereiten. Zum Abschluss unterstützt ein synchrones Tutoriumsformat die Studierenden bei allen Fragen, die gegebenenfalls noch unbeantwortet geblieben sind.
Diese beiden ergänzenden Angebote sind Teil eines größeren Rahmens: dem Tutor*innenkonzept „Proficiscere!“ des Instituts für Altertumskunde.
Das Tutor*innenkonzept „Proficiscere!“ will einen Beitrag zur Qualitätssteigerung der Lehrer*innenausbildung im Fach Latein leisten: Im Rahmen eines mehrstufigen Weiterbildungskonzepts bietet es fachlich herausragenden Studierenden die Möglichkeit, über die Ausbildung in den Bildungswissenschaften und Praxisphasen der Universität zu Köln hinaus wertvolle Unterrichtserfahrung zu sammeln. Dabei arbeiten die Studierenden auf jeder Ebene des Programms eng mit Dozierenden zusammen.
Ein dynamischer Entwicklungsprozess
Die Dozenten waren bezüglich der Übertragbarkeit ihres Lehrkonzepts in das digitale Format zunächst skeptisch, sehen den Vorgang jetzt aber überwiegend positiv – insbesondere, da sie neue Facetten der Vermittlung kennenlernen konnten: „Im Verlauf der Umsetzung waren wir selbst überrascht, wie häufig wir auch durch die Software selbst zu Änderungen inspiriert wurden“, sagt Sebastian Neuwahl.
Es habe Spaß gemacht, so Fabian Neuwahl, einen „frischen Blick“ auf die Sprachkurse zu werfen. Die Gestaltung in ihrer jetzigen Form sei das Ergebnis eines dynamischen Entwicklungsprozesses, in dem auch die anfängliche Skepsis hinsichtlich der digitalen Möglichkeiten (zumindest zum Teil) gewichen ist.
Auch die Studierenden bewerteten das Format größtenteils positiv: Obwohl sie zwar durchweg die Präsenzlehre bevorzugen, empfanden sie das Zusammenspiel von eigenständiger Vorbereitung, gemeinsamer Sitzung zur Vertiefung und begleitendem Tutorium als gute Alternative.
Aus ihrer Erfahrung haben Fabian und Sebastian Neuwahl zwei wichtige Lehren gezogen, die sie gerne weitergeben: „Beginnen Sie bei der Digitalisierung Ihrer Lehrformate nicht mit allem, also nicht mit Selbsttests, Lernmodulen, Kurzvideos, MURALs, Evaluationsbögen etc., zur gleichen Zeit. Und verlangen Sie den Studierenden nicht zu viel ab – auch wenn sie ‚digital natives‘ sind!“
Institut für Altertumskunde
fabian.neuwahl@uni-koeln.de
Institut für Altertumskunde
sebastian.neuwahl@uni-koeln.de
Medizinische Fakultät, Palliativmedizin
Palliativmedizin: Reden über existentielle Themen
Professor Dr. Raymond Voltz, Direktor des Zentrums für Palliativmedizin, beschreibt, wie es ihm gelungen ist, die Lehre der Palliativmedizin digital umzusetzen und gleichzeitig der sensiblen Thematik gerecht zu werden.
Lehre in der Palliativmedizin beinhaltet oft das Reden über existentielle Themen und das Vermitteln von Kommunikationsfertigkeiten. Daher war es vor der Pandemie einhellige Meinung, die beste Art palliativmedizinische Themen zu lehren sei die Präsenzveranstaltung. Die Pandemie hat uns gezwungen, in dieser Hinsicht radikal umzudenken. Die Rückmeldungen von Studierenden haben uns auch gezeigt, dass dieses Umdenken gut angenommen wird, was jedoch nicht bedeutet, dass wir nach der Pandemie nicht doch wieder auch anteilig zu Präsenzveranstaltungen zurückkehren werden.
Spontan und intuitiv die meisten wesentlichen Punkte dargestellt
Neben der relativ „einfachen“ Möglichkeit asynchron digitaler Lehre durch das Einstellen von besprochenen Powerpoints haben wir eine zusätzliche Methodik als hilfreich empfunden, welche eher spontan entstanden war, nämlich das Aufnehmen von Video-Clips zu bestimmten Themen im Dialog zweier Mitarbeitenden des Palliativzentrums.
Dies konnten wir im März 2020 mit relativ einfachen Mitteln, einer Handkamera, zwei Mikrophonen und zwei Mitarbeitenden des Zentrums verwirklichen. Dabei habe ich mir als Direktor des Zentrums zu den unterschiedlichen Themen unserer Veranstaltung jeweils einen erfahrenen Mitarbeitenden gebeten, sich gemeinsam mit mir vor die Kamera zu stellen und dann über das entsprechende Thema komplett spontan im Dialog zu reden.
Die Erfahrung war tatsächlich, dass wir durch diese spontane Art intuitiv die meisten wesentlichen Punkte unserer Veranstaltungen darstellen konnten.
Natürlich ist ein Kommunikationstraining zum Überbringen schlechter Nachrichten, wie wir es im PJ Startblock anbieten über eine derart asynchron digitale Lehrmethodik nicht gut zu vermitteln. Wir haben jedoch auch digitale synchrone Formate erstaunlich viel Potential, bis dahin, dass sogar Rollenspiele möglich sind. Nach unserer Einschätzung ist jedoch für das Einüben von Kommunikationstrainings die Präsenz weiterhin die beste Lehrmethodik, und wir werden sie selbstverständlich nach der Pandemie vermehrt wieder einsetzen.
Lernen ist aber nicht nur im Rahmen von institutionalisierten Studiengängen an Hochschulen möglich, sondern auch informell: ohne Noten, dafür mit persönlichem Gewinn. Wenn Sie mehr über die Palliativmedizin von Heute lernen möchten, besuchen Sie doch die Playlist Palliativmedizin auf dem YouTube-Kanal der Uniklinik Köln .
Feedback der Studierenden:
genially

Zentrum für Palliativmedizin
raymond.voltz@uk-koeln.de
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Bürgerliches Recht
Korrektoren überzeugen – wie geht das?
Studierende sind darauf angewiesen, gute Klausurergebnisse zu erzielen. Wie die Note unter der Klausur aber konkret zustande kommt, geschieht ohne ihre Anwesenheit: Der Korrektor ist dafür zuständig. Dozenten aus der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wollen Studierenden helfen, sich auf die Arbeitsweise der Korrektoren einzustellen und unnötige Fehler zu vermeiden. Das Video-Projekt „Klausurkorrektur Backstage“ erlaubt den Studierenden einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Korrektur.
„Studierende machen in Klausuren oft dort Fehler, wo sie es eigentlich gar nicht bräuchten“, ist sich Dr. Oliver Froitzheim sicher. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Wirtschaftsrecht, IPR, Rechtsvergleichung und Bankrecht ist selber Korrektor und weiß, wo es für die Klausurenschreiber hakt: „Studierende können oft das entlegendste Spezialproblem korrekt lösen“, so Froitzheim. „Da sind sie gut drin. Die Fehler werden dann aber bei den einfachsten Voraussetzungen gemacht: Zum Beispiel beim klaren und strukturierten Argumentieren, dem korrekten Zitieren von Definitionen rechtswissenschaftlicher Begriffe oder der klaren Benennung des zentralen Problems.“ Dumme Fehler, die nicht sein müssen und die zu schlechten Noten führen.
Das zu ändern ist der Dozent zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtswissenschaftlichen Fakultät angetreten: Sie produzieren Videos, in denen Studierende verfolgen können, wie ein Korrektor eine Klausur korrigiert, was er lobt, was er tadelt und wie Noten gebildet werden.
Clip in gesamter Länge auf YouTube
Starke Unterstützung aus der Fakultät
16 Videos aus verschiedenen Bereichen der Rechtswissenschaften wurden bisher auf der ILIAS-Plattform zur Verfügung gestellt. „Das sind natürlich keine realen Klausuren von Studierenden, die da korrigiert werden. Das ginge rechtlich meist gar nicht“, erklärt Froitzheim. „Aber die Korrektoren haben Klausuren bearbeitet, wie sie in vergleichbarer Form tatsächlich abgeliefert werden: Mit vielen typischen Fehlern.“
Bislang haben zehn Korrektoren aus verschiedenen Lehrstühlen bzw. Instituten Videos erstellt. Professorinnen und Professoren nehmen genauso an dem Projekt teil, wie Wissenschaftliche Mitarbeiter. Da es keine besonderen Gelder oder Stellen gibt, wird diese Mehrarbeit von den Kollegen „nebenher“ zum regulären Arbeitspensum erledigt. „Die Kolleginnen und Kollegen haben auf unsere Anfragen ganz wunderbar reagiert. Ich möchte ihnen deswegen ausdrücklich an dieser Stelle danken“, so Oliver Froitzheim. „Es sind die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses Projekt möglich machen.“
Die eigenen Erfahrungen als Student und die Verwendung von Videos als Lehrmaterial in der deutschen Hochschullandschaft haben die Kölner Rechtswissenschaftler zu dem Projekt inspiriert, so Froitzheim. Froitzheims Chef, Professor Klaus Peter Berger, sagt dazu: „Im Sommer 2019 wollte ich in meiner Funktion als Studiendekan das eLearning-Angebot unserer Fakultät auf ILIAS ausbauen. Während eines Mittagessens in der Mensa erwähnte Dr. Stephan Seiwerth, einer unserer Habilitanden, ein Projekt der Bucerius Law School in Hamburg. Kurz danach wurde ich auch von meinem Amtsvorgänger, Professor Christian von Coelln, auf dieses Projekt aufmerksam gemacht. So entstand die Idee, unser eLearning-Angebot in einer etwas modifizierten Form mit solchen Klausurvideos zu bereichern.“
Clip in gesamter Länge auf YouTube
Interessantes Projekt mit Vorteilen
„Es war sehr interessant, ein neues Feld der Lehre zu betreten“, so Froitzheim. Die konkrete Klausurkorrektur war bisher weder Bestandteil von Vorlesungen noch von Arbeitsgemeinschaften. Allenfalls nebenher und ohne festes Gesamtkonzept wurde hierauf eingegangen. „Eine hier ausdrücklich zu erwähnende Ausnahme ist die Klausurenwerkstatt von „Recht Aktiv“, die als relativ neues Lehrangebot genauso wie wir auf das Klausurenschreiben als solches abstellt“, erklärt Froitzheim.
Eine Herausforderung war die zunächst die Video-Technik, die sich Froitzheim aneignen musste: „Man musste sich zunächst in die Technik einarbeiten. Ich hatte keine Erfahrung sowohl mit Aufnahmetechnik wie auch mit dem anschließenden Videoschnitt.“ Nachdem diese Hürde genommen war, lief das Projekt aber zügig an. Zudem konnte er sich auf die Unterstützung durch die IT-Abteilung der juristischen Fakultät verlassen.
„Ein großer Vorteil unseres Projekts war die Skalierbarkeit. Wir konnten mit wenigen Videos beginnen und diese online stellen. Nach und nach kamen weitere Videos hinzu“, erinnert er sich. „Ein Projekt, dass zwingend erst dann veröffentlicht werden kann, wenn alle ihren Teil abgeliefert haben, wäre sicherlich viel komplizierter gewesen.“ Dass einzelne Videos schon online waren, motivierte zudem weitere Kolleginnen und Kollegen, auch ein Video beizusteuern.
Weiter mit der Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen
Das Projekt gedeiht und wächst und weitere Videos werden im Laufe der nächsten Zeit online gestellt werden. Im Moment sind die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen technisch durch die Funktionen von ILIAS etwas limitiert, meint Froitzheim. „Gerne würden wir etwa Links zu einzelnen Abschnitten des Videos einbinden. Dies ist allerdings nicht oder nur mit weitreichenden Einschnitten in sonstige Funktionen möglich.“
Das Feedback auf die Videos ist durchgängig sehr positiv, sowohl von den Studierenden als auch von den Dozenten, so Froitzheim: „Die Reaktionen sind sehr positiv. Die Kritik, die wir von den Studierenden bisher gehört haben, bezieht sich vor allem auf den Notenmaßstab. So werden manche der in den Videos vergebenen Noten als viel zu gut beanstandet.“ Aber: „Diese entsprechen der Notenrealität der jeweiligen Korrektoren.“
Mit dem Projekt „Klausurkorrektur Backstage“ haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der rechtswissenschaftlichen Fakultät ein neues Gebiet der Lehre betreten, damit Studierende lernen, zielgerichtet und klar zu argumentieren. Denn, wie Froitzheim den römischen Philosophen Seneca zitiert: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige“.
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Wirtschaftsrecht, IPR, Rechtsvergleichung und Bankrecht
oliver.froitzheim@uni-koeln.de
Humanwissenschaftliche Fakultät, Bildungswissenschaften
Spagat aus Wissensvermittlung und Anwendungsbezug
Neben den eigentlichen Unterrichtsfächern wie Deutsch, Chemie oder Geschichte müssen alle Lehramtsstudierenden das Fach Bildungswissenschaften studieren. Dort lernen sie sonderpädagogische Grundlagen kennen, wozu auch der Prozess der wissenschaftlichen Diagnostik gehört und eine darauf aufbauende individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Besonders wichtig in den dazugehörigen Seminaren ist die praktische Erprobung. In einem Feld, in dem es vor allem um Arbeit mit Menschen geht, ist die Herstellung dieses Praxisbezuges auf digitalem Wege eine Herausforderung. Aber machbar, sagt Michael Ehlscheid vom Department Heilpädagogik und Rehabilitation (DHR).
Das Seminar, das wir vorstellen möchten, bildet zusammen mit einer dazugehörigen Vorlesung das Modul, also eine Studieneinheit, „Diagnostik und individuelle Förderung“. Es ist im Masterstudium angesiedelt und richtet sich an angehende Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie an Gymnasien. Für uns ist das hauptsächliche Ziel des Seminars, den „Regellehrämtlern“, also nicht Sonderpädagog*innen, praktische diagnostische Kompetenzen für das breite Aufgabenfeld der inklusiven Schule zu vermitteln. Das theoretische Fundament dazu erlernen die Studierenden in der Vorlesung.
Gruppen- und Einzelarbeitsaufgaben außerhalb der Seminarzeiten
Für das Seminar haben wir, also die Lehrenden, Videos aufgenommen, in denen wir über Themen wie „Diagnostische Kompetenz“, „Verhaltensbeobachtung“, „Lese- und Rechentests“ sowie „Förderplanung“ sprechen. Das Ganze wird von einer Präsentation begleitet, die sich die Studierenden natürlich auch ohne den Vortrag anschauen können, z. B., wenn sie schnell noch eine Definition oder einen Begriff nachschlagen wollen. Außerdem gibt es für die Studierenden Gruppen- sowie Einzelarbeitsaufgaben außerhalb der Seminarzeiten sowie Live-Zoom-Sitzungen, die wir zur Vertiefung anbieten.
Studierende können Lehrvideos kommentieren
Die Lehrvideos, die wie alles andere auf der Lernplattform ILIAS zu finden sind, können sich die Studierenden jederzeit anschauen. Das ist ein großer Vorteil bspw. für diejenigen, die familiäre Verpflichtungen haben oder arbeitstätig sind. Ein großer Nachteil ist allerdings, dass sie dann nicht direkt Rückfragen stellen oder in den Austausch mit ihren Kommilitonen treten können. Das ist in einem Seminar, in dem es um praktische Erprobung und menschliches Verhalten geht, aber sehr, sehr wichtig. Mit den Zoom-Sitzungen, mit Austauschmöglichkeiten wie einem Forum oder mit der Möglichkeit, die Lehrvideos zu kommentieren sind wir diesem Problem ganz gut, wie wir meinen, begegnet.
Im folgenden Beispiel können Sie, wenn Sie möchten, den Lernprozess eines Studierenden nachvollziehen. Wir sind in der 2. Sitzung „Diagnostische Kompetenzen“.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Seminar, obwohl es sehr viel Arbeit war (und immer noch ist), da wir denken, dass uns der Spagat aus Wissensvermittlung und Anwendungsbezug ganz gut gelungen ist.
Department Heilpädagogik und Rehabilitation (DHR)
michael.ehlscheid@uni-koeln.de
Text:
Robert Hahn, Anette Hartkopf, Dr. Magdalena Spaude, Eva Schissler, Prof. Dr. Markus Ogorek, Prof. Dr. André Bresges, Prof. Dr. Peter Schilke, Anja Blode, Dr. Christoph Scheicher, Fabian Neuwahl, Sebastian Neuwahl, Prof. Dr. Raymond Voltz, Dr. Oliver Froitzheim, Michael Ehlscheid
Koordination, Interviews:
Dr. Magdalena Spaude
Audio/Video:
Adam Polczyk, Mathias Martin, Janine Klösges, Celine Junk
Titelbild:
Maya Claussen
Website Konzept, Technik, Gestaltung:
Anette Hartkopf
Biologische Vielfalt im Modellgarten
Eine grüne Insel in der Stadt: Der Modulare Modellgarten (MoMo)!
Im sommerlich bunten Modellgarten tummeln sich die verschiedensten Bienen- und Wespenarten. Sie lieben die Trockenmauern und das Insektenhaus, das Nistmöglichkeiten für alles Getier bietet, das kreucht und fleucht. Genügend Nahrung finden sie in den vielen verschiedenen Blütenpflanzen.
Gerade in Zeiten des großen Insektensterbens, der Auslaugung von Böden und des Rückgangs der Artenvielfalt bieten die vielen Pflanzen Lebensraum und Nahrung. Und neben dem Summen der Insekten ist im MoMo auch lebhaftes Vogelgezwitscher zu hören.
Wir nehmen Sie mit zu einer kleinen, virtuellen Gartenführung!
Anna Heinermann stellt den MoMo vor

Was ist der MoMo?
Der Modulare Modellgarten (MoMo) des Instituts für Biologiedidaktik an der Uni Köln bietet schon seit 2015 mitten in Köln, am Clarenbachkanal, auf knapp 500 Quadratmetern eine kleine Insel der Biodiversität. Er setzt sich aus verschiedenen Gartenelementen, sogenannten Modulen, zusammen.
Angehende Biologielehrer*innen können hier modellhaft erfahren, wie sie einen Schulgarten gestalten und nutzen können: Sie festigen im Garten ihr Wissen über die heimische Flora und Fauna und erweitern ihr Methodenrepertoire. Als Begleitung von Schulklassen an Projekttagen im MoMo sammeln sie erste praktische Lehrerfahrungen im Garten.
Ein idealer Ort für Insekten

Es gibt viel zu entdecken!
Der MoMo steckt voller Überraschungen – für Schüler*innen, Studierende, aber auch für Lehrkräfte. So gibt es zum Beispiel Brutzellen von Wildbienen von innen zu bestaunen, blühenden Salat und Zwiebeln, Samen von Radieschen, Mangold, Schnittlauch und Co. zu ernten, Kartoffeln in Eimern, Apfelbäume in Kübeln, viele essbare Wildkräuter, ein mobiles Forschungslabor unter freiem Himmel, Blüten, die aussehen wie Schlangenköpfe (der Natternkopf), extrem anhängliche Samen (von der Großen Klette) – und noch so viel mehr!
Lehr- und Lernort MoMo

Lernort für Studierende
Studierende können im MoMo nicht nur in Seminaren, sondern auch im Rahmen ihres Berufsfeldpraktikums tatkräftig mithelfen. Dabei wird im Garten in entspannter Atmosphäre viel Neues gelernt und gemeinsam ein Projekt verwirklicht.
Der Kölner Biologiestudent Timo Walter hat einen Teich im MoMo angelegt und erzählt im Video von seinen Erfahrungen.
Der Teich im MoMo

Der Modellgarten in Zeiten von Corona
Die hier abgebildeten Bilder und Videos des MoMo entstanden alle noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Während der Pandemie fanden die Seminare digital statt. Die Studierenden erhielten dabei verschiedene Aufgaben, die sie vor ihrer Haustür machen mussten: Fotografieren einer Wildbiene, Sammeln von Wildkräutern, Absolvieren einer Baumrallye.
Mittlerweile können die Studierenden wieder in Seminaren, an Projekttage und beim Berufsfeldpraktika praktische Erfahrungen im Garten sammeln. Auch die Fortbildungen für Lehrkräfte in Kooperation mit der Stadt Köln finden wieder wie gewohnt im Garten statt.
Videos: Stefan Dämmig, Adam Polczyk
Fotos: Anne Germund, Anna Heinermann, Kathrin Oeser
Text, Konzept, Technik, Gestaltung: Sarah Brender
Die Corona-Krise im Fokus der Wissenschaft
Die Corona-Krise ist die Stunde der Experten. Denn die Politik ist auf die Einschätzungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen angewiesen, um ihre Entscheidungen zu begründen. Doch auf wen soll sie hören, wenn sogar diese Experten ihre Einschätzungen ändern? Ein Kölner Erkenntnistheoretiker bietet Orientierung.
Ein Sozialpsychologe reflektiert über die Risiken und Nebenwirkungen sozialer Netzwerke in Zeiten von Corona, Wirtschaftswissenschaftler sinnieren über die Gründe für Hamsterkäufe und überlegen, wie Unternehmen ihre Lieferketten krisensicher gestalten können. Eine Juristin erklärt, warum das Recht Ärzten auf der Intensivstation keine Handlungsanweisungen geben kann. Geschäftsführer Marc Kley vom Exzellenz Start-Up Center der Universität zu Köln spricht im Interview über den Umgang mit den Auswirkungen der Krise. Und warum der Lockdown droht, eine Belastung für Familien und das soziale Hilfesystem zu werden, erklärt Nadia Kutscher, Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit.
Verschiedene Aspekte der Corona-Krise werden aus der Perspektive ihres jeweiligen Faches beleuchtet.
UPDATE:
Zur Forschung an der Universität zu Köln
Forschungsbeiträge des Zentrums für Soziales und Ökonomisches Verhalten (C-SEB) //
Exzellenzcluster ECONtribute: "COVID-19 Centre"
Zur Forschung an der Uniklinik Köln
Übersicht aktueller Meldungen zum neuartigen Coronavirus //
Neuer SARS-CoV-2 neutralisierender Antikörper wird klinisch geprüft //
Impfstoff-Studie der Kölner Universitätsmedizin //
Forschungsteam arbeitet an Corona-Schnelltest: BMBF-Förderung für gemeinsames Projekt
- Philosophie: Welchen Experten sollen wir glauben? Eine Orientierungshilfe in Zeiten von Corona von Professor Dr. Thomas Grundmann
- Medizin: Was Kölner Forscherinnen und Forscher zum weltweiten Kampf gegen COVID-19 beitragen. Über die Forschung von Professor Dr. Florian Klein und Professor Dr. Gerd Fätkenheuer an der Universitätsmedizin Köln
- Kinderschutz: „Es gibt eine hohe Dunkelziffer“. Interview mit Professorin Dr. Sibylle Banaschak, die das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) leitet
- Orientalistik: Reaktionen auf das Coronavirus im Iran, der Türkei und Zypern. Beitrag von Katajun Amirpur, Professorin für Islamwissenschaft und Béatrice Hendrich, Juniorprofessorin für Türkische Sprache und Kultur
- Physik: Mit Biologischer Physik gegen Corona - Professor Dr. Michael Lässig prognostiziert die Entwicklung von Viren
- Familie: Von Homeschooling bis Notfallbetreuung: Soziale Hilfen sind systemrelevant. Über die Forschung von Professorin Dr. Nadia Kutscher
- Sozialpsychologie: Isoliert, aber nicht allein. Ein Gespräch über die besondere Verbundenheit in digitalen Netzen mit Privatdozent Dr. Jan Crusius
- Gesellschaft & Wirtschaft: Hamsterkäufe – ein Versuch der Rebellion gegen die eigene Hilflosigkeit? Über eine Studie von Professor Dr. André Marchand, Juniorprofessor Dr. Martin Fritze und Doktorandin Friederike Gobrecht
- Recht: Dürfen in der Corona-Krise auch bei uns die Krankenhäuser entscheiden, vorrangig junge Menschen zu behandeln? Ein Beitrag von Professorin Dr. Dr. Frauke Rostalski
- Wirtschaft: Stresstest für Lieferketten: Interview mit Professor Dr. Fabian J. Sting
- Gründungen: „Es ist die Natur eines Start-ups, schnell neue Ideen umzusetzen": Geschäftsführer Marc Kley über den Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Exzellenz Start-up Center
- Hilfen für Start-ups: „Zwei Tage niedergeschlagen sein und dann nach kreativen Lösungen suchen“: Gründer Malte Hendricks und Tim Breker im Audiointerview
Welchen Experten sollen wir glauben?
Eine Orientierungshilfe in Zeiten von Corona von Professor Thomas Grundmann
In seiner jüngsten Stellungnahme hat der Deutsche Ethikrat zu Recht betont, dass nicht die Wissenschaft, sondern die dafür demokratisch gewählten Repräsentanten die politischen Entscheidungen über Ausgangssperren oder Schulschließungen treffen. Dabei müssen nicht nur medizinische und wirtschaftliche Fakten berücksichtigt werden, sondern es muss auch normativ abgewogen werden, wie der Schutz der Gesundheit, Freiheitsrechte und der dauerhafte Wohlstand gegeneinander gewichtet werden. Dennoch ist wissenschaftliche Beratung unverzichtbar.
Die politischen Entscheidungen sollen auf der Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Daten, Prognosen und Empfehlungen erfolgen. Anders als in den USA, wo der Präsident die Corona-Erkrankung anfangs noch für einen „Trick“ der Demokraten hielt, und anders als in Brasilien, wo Bolsonaro jüngst sogar zum Boykott der von den Gouverneuren aufgrund von Expertenempfehlungen verhängten Ausgangssperren aufgerufen hat, ist die derzeitige öffentliche Stimmung in Deutschland uneingeschränkt expertenfreundlich.
Keine Talkshow kommt ohne Virologinnen oder Epidemiologen aus, Wissenschaftler loben ausdrücklich Gesundheitsminister Jens Spahn dafür, dass er seine Entscheidungen in engster Abstimmung mit den medizinischen Expertinnen und Experten trifft, und der Corona-Podcast des Berliner Virologen Christian Drosten hat inzwischen fast Kultstatus. Die Öffentlichkeit und die Politik haben also ein offenes Ohr für die wissenschaftlichen Experten.
Experten ändern in dieser Krisenzeit jedoch ihr Urteil in Windeseile. So sah Christian Drosten noch am 27. Februar keinen Grund, auf Italienreisen zu verzichten. Er begründete dies mit dem Hinweis auf die geringe Infektionsdichte. Ein Ansteckungsrisiko sei niedrig. Eine Einschätzung der tatsächlichen Gefahrenlage, die aus heutiger Sicht eindeutig falsch war.
Auch bei vielen staatlichen Maßnahmen ist auffällig, wie schnell die Experten ihre Einschätzung dazu ändern. Erst wurde das Verbot von Großveranstaltungen für übertrieben gehalten, dann empfohlen. Ähnlich wechselhaft verliefen die Einschätzungen mit Blick auf Schulschließungen, Kontaktsperren oder Atemmasken. Die Urteile der Experten haben offensichtlich keine lange Halbwertszeit.
Die Verwirrung wird noch dadurch gesteigert, dass die Experten nicht mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Dennoch zeichnet sich eine deutlich überwiegende Mehrheitsmeinung unter den wahrnehmbaren Stimmen ab: Die allermeisten Epidemiologen und Virologen prognostizieren zur Zeit extrem dramatische Verläufe der Corona-Pandemie einschließlich einer totalen Überlastung der Intensivmedizin und Hundertausenden, wenn nicht Millionen von Toten in einzelnen Ländern, sollte es nicht zu einer staatlich verordneten drastischen sozialen Distanzierung kommen.
Die meisten Experten folgen dabei den mathematischen Modellierungen einer Studie des Londoner Impirial College. Andere Modellrechnungen der Universität Basel und der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Demgegenüber gibt es jedoch eine wachsende Zahl abweichender Stimmen, von denen einige wichtige in der letzten Woche in zwei Artikeln des Onlinemagazins OffGuardian zusammengestellt wurden, darunter hoch renommierte Wissenschaftler aus Oxford oder Stanford. Sogar ein Nobelpreisträger befindet sich auf der Liste.
Alle Abweichler eint die These, dass die Mainstream-Wissenschaftler und die Presse die Brisanz der Lage unbegründet dramatisieren und unnötig Panik verbreiten.
Es werden vor allem drei Gründe genannt:
Erstens wird bemängelt, dass die Infektions- und Todeszahlen nicht in ein Verhältnis zu den entsprechenden Zahlen bei saisonalen Grippen gesetzt werden. Wenn man berücksichtige, dass in Grippezeiten in Deutschland jährlich bis zu 25.000 Menschen sterben (beispielsweise bei der besonders schweren Epidemie 2017/18) oder in Italien wöchentlich bis zu 500 Personen, dann lägen die jetzigen Zahlen immer noch im normalen Bereich.
Zweitens hat der hoch renommierte Gesundheitswissenschaftler John Ioannidis von der Stanford Universität darauf hingewiesen, dass wir derzeit einfach gar nicht wissen, wie viele unbemerkte Infektionen es tatsächlich gibt, sondern die Sterblichkeit nur anhand der auffälligen, relativ schweren Krankheitsverläufe berechnen würden. Dadurch komme es zu einer Überschätzung der Sterblichkeit. Ioannidis spricht von einem „Fiasko fehlender Evidenz“.
Drittens geht die Oxforder Epidemiologin Sunetra Gupta in ihrer jüngsten Studie sogar noch einen Schritt weiter und behauptet, dass sich in England durch unbemerkte Infektionen schon eine weitgehende Herdenimmunität der Gesamtbevölkerung eingestellt habe, sodass ein explosionsartiger weiterer Verlauf der Epidemie gar nicht zu erwarten sei (die sogenannte Eisberghypothese).
Wenn man sich ernsthaft klarmacht, wie rasant sich das herrschende Mehrheitsurteil zur Corona-Infektion unter den medizinischen Experten ändert und dass dieses herrschende Urteil zudem von anderen Experten massiv bezweifelt wird, dürfen sich Öffentlichkeit und Politik dann weiterhin an einem solchen Urteil orientieren? Obwohl es zunächst überraschend klingen mag: Ja, sie sollte sich auch unter diesen Umständen am herrschenden Expertenurteil orientieren. Warum?
Betrachten wir zunächst den rasanten Wechsel der Expertenurteile. Spricht er tatsächlich gegen deren Glaubwürdigkeit? Ganz und gar nicht. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass sich die Infektionslage selbst rasant ändert. Was also eben noch unangemessen war, ist es jetzt schon dringend geboten. Und entsprechend muss sich auch das Urteil der Experten ändern, damit es situationsbezogen wahr bleibt. Außerdem befinden sich die Experten bezüglich der Corona-Infektion zurzeit in einer besonders misslichen Erkenntnislage: Sie wissen einfach sehr vieles nicht und lernen durch die stark angekurbelte Forschung schnell hinzu. Da Experten vieles noch nicht wissen, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sich ihr Urteil hinterher häufig als falsch herausstellt. Und da die Experten beständig neue und mehr Daten bekommen, ist es nur vernünftig, das Urteil diesen neuen Daten beständig anzupassen. Ein rationales Urteil muss den Daten entsprechen. Ändern sich die Daten, dann muss sich auch das Urteil ändern. Trotz dieser ständigen Änderungen bleibt das jeweils aktuelle Expertenurteil die bestmögliche Entscheidungsgrundlage.
Aber was ist mit den Expertinnen und Experten, die vom herrschenden Expertenurteil abweichen? Hier lohnt es sich, noch einmal genauer hinzusehen. Nicht jedes sogenannte Expertenurteil sollte gleich viel zählen. Auf den Listen des OffGuardians befinden sich viele Personen, die man nicht zu den wirklich relevanten Experten zählen darf, weil sie entweder keine Wissenschaftler sind oder weil sie nicht mehr aktiv an der Forschung teilnehmen oder weil sie zwar aktive Wissenschaftler sind, aber gar nicht im relevanten Fachgebiet arbeiten (wie beispielsweise der Chemie-Nobelpreisträger Michael Levitt). Interessanterweise sind es gerade diese Personen, die den gravierenden Unterschied zwischen der jetzigen Infektion und den saisonalen Grippen komplett unter den Tisch fallen lassen: dass ein natürlicher Stopp der explodierenden Infektionszahlen vorerst nicht zu erwarten ist, weil es keinerlei Immunität in der Bevölkerung gibt. Selbst wenn die Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht jeden erschrecken mögen, so ist dies doch sehr bald erwartbar.
Wenn man die genannten Personen abzieht, wird die Liste der abweichenden Expertenstimmen kürzer, aber sie ist nicht leer. Unter ihnen befinden sich namhafte medizinische Spezialisten von Spitzenuniversitäten. Kann man deren Urteil einfach ignorieren? Hier kommt nun eine weitere Überlegung ins Spiel. Für das Gewicht, das man einer Expertenposition gibt, spielt die Anzahl ihrer Anhänger eine entscheidende Rolle. Zahlen entscheiden hier durchaus. Und das lässt sich leicht erklären. Während Laien Urteile von anderen oft einfach übernehmen und deshalb breite Akzeptanz nicht unbedingt für die Wahrheit spricht, haben Experten die zuverlässige Fähigkeit und aufgrund des wissenschaftlichen Wettbewerbs auch den Anreiz, selbständig und kritisch nachzudenken. Dass eine Position dem Test der kritischen Überprüfung durch Kollegen standhält spricht deshalb typischerweise für deren Wahrheit. Das bedeutet für die abweichenden Experten, dass sie zunächst von ihren Kollegen akzeptiert werden müssen, damit sie öffentlich als glaubwürdig gelten können. Genau das ist im Fall der Eisberghypothese von Sunetra Gupta nicht passiert. Weitere Experten haben die Studie wegen spekulativer Annahmen massiv kritisiert.
In einer Hinsicht ist es mit dem vorherrschenden Urteil zur Corona-Infektion ähnlich wie mit den herrschenden Urteilen zum Klimawandel oder zur Nützlichkeit von Impfungen. Es gibt Abweichler. Manche von ihnen muss man nicht ernst nehmen, weil es Spinner oder Verschwörungstheoretiker sind. Andere muss man nicht ernstnehmen, solange ihre Auffassungen keine breite Akzeptanz unter Experten finden.
In anderer Hinsicht unterscheidet sich die wissenschaftliche Diskussion über die Corona-Pandemie jedoch sehr deutlich von den Diskussionen über den Klimawandel oder Impfungen. Weil die Experten noch extrem wenig wissen und weil sie rasant hinzulernen, ändert sich das Expertenurteil sehr schnell und ist es auch noch relativ unsicher.
Bislang gibt es nur durch wenige Daten gestützte Schätzungen der Dunkelziffer von Infizierten. Erst repräsentative Antikörpertests werden es ermöglichen, diese Zahl exakt zu bestimmen. Deshalb soll es diese Tests demnächst geben. Es lässt sich demnach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht völlig ausschließen, dass COVID-19 am Ende sehr viel weniger gefährlich ist, als die Mehrheit der Experten es derzeit vermutet. Dann hätten die Abweichler Recht gehabt; und das wäre eine gute Nachricht. Aber bis dahin gebietet es uns die Vernunft, der herrschenden Expertenmeinung zu folgen.
Über den Autor:
Professor Dr. Thomas Grundmann hat an der Universität zu Köln die Professur für Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Logik inne.
Information zum Text:
Dieser Beitrag ist zuerst am 3. April 2020 als Gastbeitrag unter dem Titel Wer verdient Vertrauen? im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen.
Was Kölner Forscherinnen und Forscher zum weltweiten Kampf gegen COVID-19 beitragen

Von Stephanie Wolff
Derzeit laufen zehn klinische Studien mit Corona-Infizierten am Medizinstandort Köln. Federführend für die Kölner Forschung sind unter vielen anderen der Virologe Florian Klein und der Infektiologe Gerd Fätkenheuer. Sie setzen große Hoffnungen in das Ebola-Medikament Remdesivir und in Therapien mit Antikörpern, die aus dem Blut von Genesenen gewonnen werden können.
Klinische Studien sind für die Entwicklung neuer Therapiemöglichkeiten unerlässlich. Nicht nur in Köln, sondern auf dem ganzen Globus forschen die Fachleute in einem nie da gewesenen Ausmaß an Diagnose-, Therapie- und Präventionsmöglichkeiten, um die lebensbedrohliche Erkrankung zu stoppen. Derzeit sind 1.518 Studien zu COVID-19 weltweit im Register „clinicaltrials.gov“ gelistet. 18 Medikamentenstudien sind deutschlandweit registriert, zehn Studien sind derzeit an der Kölner Universitätsmedizin aktiv oder in Planung.
Keine Therapie ohne sorgfältige Prüfung
Die Professoren Gerd Fätkenheuer (Infektiologie) und Florian Klein (Virologie) gehören zu den Forschenden an der Universitätsmedizin Köln, die die Therapie für Corona-Erkrankte in klinischen Studien vorantreiben. „Bei der Bekämpfung der neuartigen Erkrankung verfolgen wir unterschiedliche Lösungsansätze“, so Gerd Fätkenheuer. „Wir erproben den Einsatz neuer viraler Hemmstoffe. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herrn Professor Klein haben wir zudem die Möglichkeit, neue immuntherapeutische Ansätze zeitnah klinisch zu untersuchen. Selbst wenn der gesellschaftliche Bedarf nach einer Therapie gegen Covid-19 derzeit extrem hoch ist, gilt auch hier: Es wird keine Therapie in die breite Anwendung kommen, die nicht vorher sorgfältig klinisch geprüft wurde.“
Welches Medikament könnte wirken?
Eines der vielversprechendsten bereits bekannten Präparate ist das ursprünglich für die Behandlung von Ebola entwickelte Medikament „Remdesivir“. In klinischen Studien – auch an der Kölner Uniklinik – wird getestet, ob sich dieses Arzneimittel für die Behandlung von COVID-19 eignet. Professor Fätkenheuer ist der deutsche Studienleiter eines internationalen Konsortiums zur Erforschung von Remdesivir. „Die wegen der Corona-Pandemie im Rekordtempo vorangetriebene Studie ist inzwischen weitgehend abgeschlossen“, sagt der Infektiologe. „Das Präparat Remdesivir ist die erste Substanz, für die eine Wirksamkeit in einer kontrollierten klinischen Studie nachgewiesen wurde. Sie verkürzt den Krankheitsverlauf bei betroffenen Patienten. Binnen weniger Wochen wird Remdesivir zum Einsatz bei Corona-Erkrankten zur Verfügung stehen.“ Die Studie zeigt auch, dass die Substanz insgesamt sehr gut verträglich ist.
Einen Antikörperkandidaten finden
Eine weitere Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Klein arbeitet mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) an der Identifizierung und Verwendung von SARS-CoV-2 neutralisierenden Antikörpern, mit deren Hilfe sich COVID-19 behandeln lassen soll – und Infektionen auch verhindert werden könnten. Die so wichtigen neutralisierenden Antikörper tragen Patientinnen und Patienten in ihrem Blut, die bereits von COVID-19 genesen sind. „Unser Ziel ist es, aus dem Blut der wieder gesunden Patienten spezifische Antikörper zur Entwicklung eines klinisch wirksamen Arzneimittels zu verwenden“, erklärt Klein. Klein konnte bereits hochpotente Antikörper anderer Viren wie Ebola und HIV isolieren. Nach Abschluss der Untersuchungen soll ein potenter Antikörperkandidat für die klinische Erprobung zur Verfügung stehen.
Möglichkeit, von laufenden Studien zu profitieren
Etwa 600 klinische Studien laufen jährlich an der Uniklinik zu unterschiedlichsten Fragestellungen und Indikationen. „Patientinnen und Patienten der Kölner Universitätsmedizin profitieren unmittelbar von der Teilnahme an einer unserer klinischen Prüfungen“, unterstreicht Professorin Dr. Esther von Stebut-Borschitz, Wissenschaftsdekanin an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. „Ein Großteil aller schwer an COVID-19 Erkrankten in der Region hat die Möglichkeit, in laufende Studien eingeschlossen zu werden und so Zugang zu noch nicht zugelassenen Arzneimitteln und Behandlungsmethoden zu erhalten. Die Teilnahme an einer klinischen Studie erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und ärztlicher Aufsicht. Für uns ist es selbstverständlich, uns mit unserer ausgewiesenen Expertise an der weltweiten Suche nach einer Therapie zu beteiligen.“
Weitere Forschung zum Coronavirus der Kölner Universitätsmedizin:
„Es gibt eine hohe Dunkelziffer“

Es war eine der großen Sorgen nach dem Corona-Shutdown im März: Werden Kinder zuhause öfter misshandelt und keiner bekommt es mit? Die soziale Aufmerksamkeit nimmt ab, familiärer Stress wächst unter den Ausgangsbeschränkungen. Kindesmisshandlungen geschehen mehr denn je im Verborgenen – das zumindest befürchtet die Rechtsmedizinerin Professorin Dr. Sibylle Banaschak, die das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) leitet.
Interview mit Sibylle Banaschak
Frau Professorin Banaschak, der Kinderschutzbund hat festgestellt, dass Meldungen wegen Kindesmisshandlung bei den Jugendämtern offenbar drastisch gesunken sind. Das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) berät auch Praxen und Kliniken, also diejenigen Instanzen, die einen Großteil der Meldungen möglicher Kindesmisshandlung machen. Wird weniger gemeldet, weil weniger Kinder in die Artpraxen kommen?
Das KKG wird auch in Corona-Zeiten kontinuierlich angefragt. Wir sehen derzeit aber weniger Bilder von Hämatomen, also Verletzungen, die nicht zwingend behandelt werden müssen. Was selbstverständlich nicht heißt, dass körperliche Gewalt, aber auch sexuelle oder emotionale Misshandlung und Vernachlässigung an Kindern, unter Corona zurückgegangen ist. Die relativ geringe Meldequote erklärt sich tatsächlich damit, dass die Orte, an denen misshandelte Kinder auffallen können, über Wochen größtenteils geschlossen waren und nur schrittweise erst wieder auf ein normales Level hochfahren können.
Laut polizeilicher Kriminalstatistik sterben in Deutschland durchschnittlich zwei Kinder pro Woche aufgrund von Gewalt oder Vernachlässigung. Sozialverbände befürchten seit Beginn des Corona-Shutdowns eine Zunahme an häuslicher Gewalt. Teilen Sie diese Einschätzung?
Die Zahlen der kriminalpolizeilichen Statistik beziehen sich auf bekannt gewordene Straftaten. Das ist tatsächlich bei dieser Frage ein unzureichender Maßstab. Die Zahl der tatsächlich misshandelten, missbrauchten und vernachlässigten Kinder liegt vermutlich um ein Vielfaches höher. Social Distancing, das Wegbrechen von Hilfe- und Unterstützungssystemen sowie Ausweichmöglichkeiten können in diesen Zeiten familiäre Krisen befeuern und häusliche Gewalt verstärken. Mein Eindruck: Es gibt eine hohe Dunkelziffer, die ansteigt, je weniger Außenkontakte es gibt. Die Kliniken und Praxen sind leer, Schulen und Kitas waren geschlossen – mit der Folge, dass Gewalt und Vernachlässigung an Kindern viel weniger gesehen wird. Weniger an das Jugendamt gemeldete Kinder bedeutet derzeit also nur, dass weniger Fälle von Kindesmisshandlung sichtbar werden.
Gibt es eine Chance, die Misshandlung später festzustellen?
Das Problem ist, dass Hämatome abheilen. Diese wichtigen Zeichen von Kindesmisshandlung können mit einer bestimmten zeitlichen Distanz nicht mehr gesehen werden. Ob die älteren Kinder später vermehrt berichten, müssen wir abwarten.
Gibt es einen spezifischen Maßstab für die Beurteilung familiärer Gefährdungssituationen für Kinder?
Wenn Jugendämter die Frage stellen, „Welche Eltern sind gut genug?“, fragen wir uns: „Ist das Kind sicher?“ Was zählt ist stets der Hinweis auf Gefährdung, nicht der eigene Maßstab.
Ist Kindeswohlgefährdung ein schichtspezifisches Problem?
Armut gilt als Risikofaktor, aber auch ein niedriger Bildungsstand, frühe Elternschaft, psychische Probleme, psychosozialer Stress. Familiäre Konfliktsituationen sind vielfältig. Tatsächlich findet Gewalt an Kinder in allen sozialen Schichten statt – es ist ein übergreifendes, gesellschaftlich relevantes Problem. Beispielsweise gibt es eine physische und eine emotionale Form der Vernachlässigung, die übrigens den größten Part bei der Verletzung des Kindeswohls ausmacht. Auch Gewalt existiert auf emotionaler und physischer Ebene. Wir beurteilen den Einzelfall, unabhängig von Herkunft und Wohnort. Die soziale Herkunft ist kein Bestandteil der Diagnose.

Seit gut einem Jahr gibt es das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen. Sie beurteilen mit drei weiteren Rechtsmedizinerinnen Verdachtsfälle von Kindesmisshandlung und -missbrauch, auch sexuellem Missbrauch, und beraten zum weiteren Vorgehen. Wie sieht das genau aus?
„Das KKG bietet rund um die Uhr eine Telefonberatung für alle mit dem Kindeswohl betraute Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen für ganz Nordrhein-Westfalen an. Wir können Verdachtsfälle über ein Online-Konsil in Augenschein nehmen: Sind das Spuren eines Unfalls oder einer Misshandlung? Wenn sich Ärzte und Ärztinnen in Praxen und Kliniken bei der Diagnose unsicher sind, können sie über eine gesicherte Datenverbindung Bilder hochladen und Befunde fachlich durch unser Team bewerten lassen. Diese rechtsmedizinische Mitbeurteilung ist übrigens kostenlos.“
Außerdem bieten Sie Schulungen für Akteure im Gesundheitswesen an. Was ist Ihnen in diesen Zeiten besonders wichtig?
In den letzten Wochen mussten wir mit unseren Präsenz-Schulungen komplett aussetzen. Über 30 Schulungen sind aufgrund von Corona ausgefallen. Für Schulungen hatten wir vom Start weg einen regelrechten Anfrageboom und haben im letzten Jahr schon viel erreicht – Aufklärung, Austausch und interdisziplinäre Vernetzung ist ungemein wichtig beim Kinderschutz.
Wie schätzen Sie den konkreten Fortbildungsbedarf ein?
Das Thema Kindesmisshandlung ist komplex, das KKG hebt das Thema qua seiner Existenz in die fachöffentliche Wahrnehmung. Es gibt erfreulich viel Interesse. Wir möchten erreichen, dass alle Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen und mit Kindern arbeiten, für Hinweise auf Gewalt und Vernachlässigung bei Kindern sensibilisiert werden. Wir haben jetzt einen Schulungsstau, den wir nicht 1:1 über die nun aufgesetzten Online-Schulungen auflösen können. Das Thema vermittelt sich besser in einem geschützten, realen Raum und in der direkten Begegnung.
Das Gespräch führte Stephanie Wolff.
Zur Person:
Professorin Dr. med. Sibylle Banaschak ist eine deutschlandweite Spezialistin für körperliche Misshandlungen und Missbrauch an Kindern. Die Rechtsmedizinerin mit dem thematischen Schwerpunkt klinische Rechtsmedizin diagnostiziert seit zwanzig Jahren Spuren und die typischen Merkmale von Misshandlungen an Kindern und hat mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen ein medizinisches Standardwerk zu dem Thema verfasst. Banaschak ist selbst Mutter eines 15-jährigen Sohnes und einer achtjährigen Tochter.
Über das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) NRW
Das Kompetenzzentrum Kinderschutz im Gesundheitswesen (KKG) NRW wird seit April 2019 am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW mit rund zwei Millionen Euro gefördert. Es ist ein Kooperationsprojekt mit den Vestischen Kinder- und Jugendkliniken Datteln, dort in der Abteilung Medizinischer Kinderschutz unter Leitung von Dr. med. Tanja Brüning. Die Förderung läuft zunächst noch bis März 2022.
Die Aufgabe des Kompetenzzentrums besteht darin, Ärztinnen, Ärzte und alle weiteren Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen bei Fragen rund um die Thematik des medizinischen Kinderschutzes zu beraten. Der Standort in Datteln konzentriert sich stärker auf chronische Verläufe sowie Folgen von Vernachlässigung oder der Zeugenschaft von Gewalt, der Standort in Köln stärker auf körperlichen Missbrauch und Misshandlung. Neben der Leiterin Professorin Dr. med. Sibylle Banaschak gehören Dr. Judith Froch-Cortis, Dr. Katharina Feld und Dr. Svenja Binder zum Kölner Team.
Weitere Informationen:
Corona im Fokus der Orientalistik

Die Corona-Pandemie betrifft Menschen weltweit. Béatrice Hendrich, Juniorprofessorin für Türkische Sprache und Kultur, und Katajun Amirpur, Professorin für Islamwissenschaft an der Universität zu Köln, beschäftigen sind mit der Situation im Iran, der Türkei und Zypern. Gibt es dort jeweils Besonderheiten in der Reaktion auf das Virus? Welche Rolle spielt dabei die Religion? Gibt es konkrete religiöse Bräuche, die jetzt nicht mehr oder in abgewandelter Form stattfinden müssen? Die beiden Wissenschaftlerinnen haben diese Fragen für uns beantwortet.
Reaktionen auf das Coronavirus im Iran, der Türkei und Zypern
Von Katajun Amirpur und Béatrice Hendrich
In der Türkei schien die Corona-Pandemie lange Zeit keine Rolle zu spielen. Während Italien oder Heinsberg mit großen Zahlen kämpften, freute man sich in der Türkei, wenigstens offiziell und in den Medien, dass keine Infektionen bekannt wurden.
Auf Zypern hingegen wurde schon die Möglichkeit einer Infektion in politischen Aktivismus umgemünzt: Bereits Ende Februar wurden mit dem Argument, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, vier der neun Grenzübergänge zwischen dem Norden und dem Süden der Insel geschlossen. Da auch der Checkpoint mitten in der geteilten Hauptstadt, in Nicosia komplett geschlossen wurde, kam es zu Demonstrationen auf beiden Seiten. Die Befürworter der Wiedervereinigung fürchteten nämlich, dass unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes die schwer erkämpften Annäherungen zwischen Nord und Süd bewusst zerstört werden sollten. In der Folge wurde der Grenzverkehr vollständig eingestellt, was zu vielen wirtschaftlichen und persönlichen Härten führte. Die schrittweise Öffnung der Übergänge ist erst ab Juni ins Auge gefasst – lange nach der Wiedereröffnung von Frisören und Stränden.
In Iran hatte man schon früh hohe Infektionszahlen. Die Islamische Republik gehört zu den zehn am stärksten betroffenen Ländern der Welt. Doch die Regierung hatte die Krise lange Zeit heruntergespielt. Wohl um zu vermeiden, dass noch weniger Menschen an den Parlamentswahlen im Februar teilnehmen, als ohnedies angesichts der schon länger bestehenden Systemkrise und daraus resultierenden Wählerapathie erwartet, hatte man die Berichte von Ärzten ignoriert. Als Mitte Februar die ersten Toten, bei denen man als Ursache Corona vermutete, in der Stadt Qom gemeldet wurden, verschwieg die Regierung die Vorfälle.
Besonderheiten in der Reaktion auf das Virus
Der Umstand, dass es in der Türkei „mit Verzögerung“ zu nennenswerten Infektionszahlen kam, führte zur Produktion recht eigenwilliger Thesen: Einige Zeit stand hier die vermeintliche genetische Besonderheit der Türken im Mittelpunkt. Da die Türken der weißen Rasse, die Chinesen hingegen der gelben angehörten – lange Zeit offizielle Lehre der türkischen Republik, wenn auch weniger populär in der Gegenwart -, werde die Pandemie die Türkei verschonen. Ebenso beliebt war der Verweis auf den Brauch, Kölnisch Wasser in großen Mengen zu verwenden, oder auf die islamischen Reinheitsgebote. Beides seien traditionelle Hygienemaßnahmen, die den Ausbruch von ansteckenden Krankheiten verhinderten. Doch die Freude an der türkischen Genetik währte nur kurz – als im letzten Drittel des Monats März die Infektionsrate einen exponentiellen Verlauf zu nehmen begann, schlug die Stunde der einschneidenden Maßnahmen – manchmal weniger effektiv als brachial. Das öffentliche Leben wurde in anderen Bereichen als in Deutschland verstärkt begrenzt: Eine komplette Ausgangssperre für Menschen unter 20 und über 65 Jahren wurde Anfang April verhängt. Ab Anfang Mai erging für die Metropolen ein komplettes Ausgangsverbot während der Wochenenden – ein Erlass, der manchen an vergangene Putsche erinnerte, wie überhaupt die Frage der Versammlungs-, Reise- und Ausgangsverbote in der Türkei eine ganz andere politische Dimension als in Deutschland hat. Ab Anfang Juni soll die Reisefreiheit innerhalb der Türkei wiederhergestellt und Restaurants, Geschäfte und so weiter unter Beibehaltung der Hygieneregeln eingeschränkt geöffnet werden.
Auch in Iran wurden eigenwillige Thesen formuliert: Nachdem das Vorhandensein des Virus dann nicht mehr zu leugnen war, bezeichnete Irans oberster religiös-politischer Führer Ali Khamenei es Anfang März als „keine so große Tragödie“. Als sich auch die Tragödie nicht mehr leugnen ließ, griff die Führung zu Verschwörungstheorien und machte ganz ähnlich wie der hier Attackierte ausländische Mächte verantwortlich: Hinter der Corona-Epidemie stecke eine biologische Attacke des Erzfeindes USA und seines Präsidenten Trump, hieß es von Irans oberster Kanzel herab.
Dann erklärte Staatsoberhaupt Khamenei in seiner Predigt zum iranischen Neujahrsfest am 22. März, für den Ausbruch der Pandemie seien neben den üblichen menschlichen Feinden auch Dschinnen, mithin religiöse böse Geister verantwortlich. Diese Äußerung war allerdings selbst für iranische Verhältnisse so bizarr, dass man sie im offiziellen Transkript wegzensierte. Sie ist nur noch in den im Netz kursierenden Videos zu finden, die von vielen Iranern hämisch kommentiert werden, für die der Glaube an Dschinnen absurd ist.
Die Rolle der Religion
In der Türkei stand am Anfang der Corona-Krise der Streit um die Behandlung der von der sogenannten Kleinen Wallfahrt zurückkehrenden Mekka-Pilger. Während von öffentlicher Seite betont wurde, dass alle Pilger sich 14 Tage in staatlicher Quarantäne aufhalten müssten, bevor sie endgültig nach Hause reisen konnten, kritisierte die säkulare Gesellschaft, dass diese Maßnahmen kaum umgesetzt worden seien. Der Staat habe wohl Angst, es sich mit der religiösen Wählerschaft zu verderben.
Die staatlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden dann aber durch das Amt für religiöse Angelegenheiten massiv unterstützt. Ohnehin ist das Amt direkt dem Staatspräsidenten untergeordnet. So lautete die Parole also nicht, dass Gott die Rechtgläubigen von der Strafe, der Infektion, verschonen werde, sondern dass es dem Islam entspreche, die Regeln einzuhalten.
Allerdings haben sich nicht alle Muslime dieser rationalistischen Interpretation angeschlossen. Verbotene religiöse Zusammenkünfte zur Infektabwehr fanden durchaus statt. Auch die Interpretation der Krankheiten als eines der Zeichen der herannahenden Apokalypse war zu vernehmen.

Auf Zypern schloss sich die muslimische Religionsbehörde im Norden dem türkischen Kurs an. Viel schwerer tat sich die politisch mächtige Orthodoxe Kirche Zyperns. Bis heute lehnt sie ab anzuerkennen, dass der aus einem gemeinsamen Kelch verteilte Wein der Heiligen Kommunion ein Infektionsrisiko darstellen könnte. Die Gottesdienste wurden nur für sehr kurze Zeit und widerwillig ausgesetzt.
In der Tat spielte in Iran beim Ausbruch der Pandemie die Religion eine große Rolle. Dass die Pandemie gerade in dem Pilger- und Studienort Qom ausbrach und sich von hier aus rasch verbreitete, war vermutlich kein Zufall. Man geht inzwischen davon aus, dass einer der rund 600 hier lernenden chinesischen Religionsstudenten das Virus nach Iran brachte. Und was die Verbreitung anbelangt: Es herrscht überaus großer Andrang am Schrein. Und nach schiitischem Brauch küssen die Pilger den Schrein der hier begrabenen Fatima Masuma, um ihren Bitten Nachdruck zu verleihen.
Als die Forderung aufkam, die beiden wichtigsten in Iran gelegenen Pilgerorte, Qom und Maschhad wegen der immensen Ansteckungsgefahr zu schließen, hieß es zunächst, gerade in diesen schweren Zeiten sei Religion ein Anker für die Menschen.
Schließlich setzte sich aber auch in Bezug auf die religiösen Stätten der Verstand durch. Auf die religiösen Befindlichkeiten der Bürger nahm die Regierung plötzlich nur noch wenig Rücksicht. Dass hier in der Tat Widerstandspotential vorhanden ist, zeigte sich aber, als die Behörden am 16. März ankündigten, sie würden den Schrein des achten Imams der Schia, Reza, in der Stadt Maschhad sowie den seiner Schwester Fatima schließen. Kurz nach der Ankündigung versammelten sich wütende Demonstranten vor den beiden Heiligtümern und versuchten, die Eingangstore zu durchbrechen. Diese Aktionen stießen auf der anderen Seite des religiösen Spektrums sofort auf Kritik. Die Angriffe seien der Inbegriff religiöser Ignoranz, erklärte der moderate Abgeordnete Ahmad Mazani.
Auswirkungen auf religiöse Bräuche: Religiöser Pragmatismus und Ramadan im Lockdown
Für alle Muslime weltweit stellte es eine besondere Härte dar, dass ausgerechnet der Fastenmonat Ramadan mit seinen religiösen und sozialen Riten, die gerade auf die Herstellung von Gemeinschaft abzielen, in die Hochphase des Lockdowns fiel. In der Türkei versuchte die Religionsbehörde den Familien das Fastenbrechen im kleinsten Rahmen etwas schmackhafter zu machen, indem sie darauf verwies, wie gut es den Familien getan habe, gemeinsam so viel Zeit zu verbringen, gemeinsam den Koran zu lesen und „aufmerksamer“ geworden zu sein.
Die iranische Regierung bewies religiösen Pragmatismus, als Ali Khamenei ein Rechtsgutachten erließ, das es den Gläubigen erlaubte, die Fastenregeln des Monats Ramadan auszusetzen. Gläubige werden vom religiösen Fasten entschuldigt, wenn es „eine Krankheit verursachen, verstärken oder verlängern“ kann, erklärte er. Damit entließ er die Gläubigen in einer für die Schia charakteristischen Art des Pragmatismus aus einer religiösen Pflicht – denn diese Formulierung ist – und so war es sicherlich gedacht – sehr weit auslegbar.
(Stand: Juni 2020)
Weitere Informationen:
Mit Biologischer Physik gegen Corona
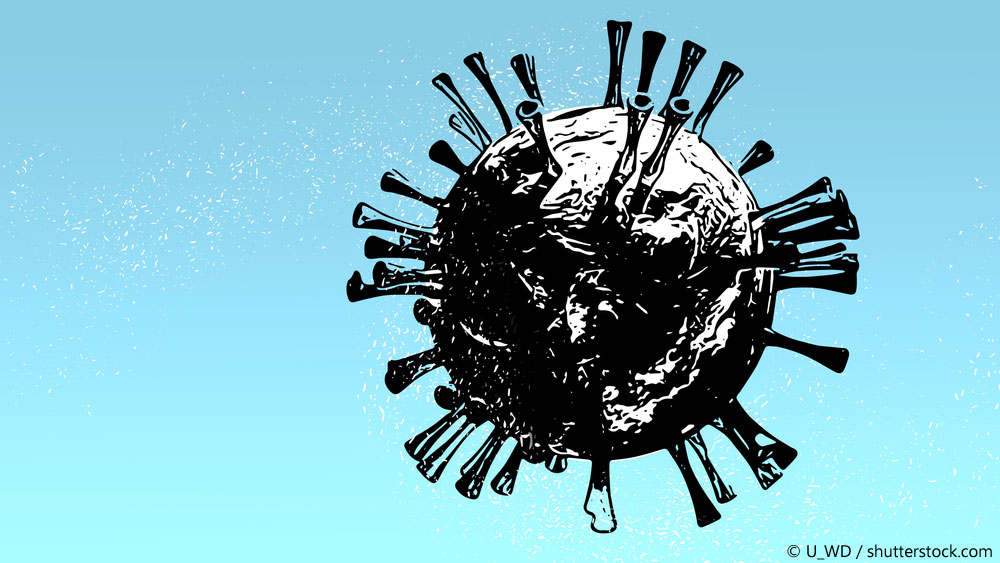
Von Robert Hahn
Wie geht es mit der Corona-Pandemie weiter? In welcher Weise wird sich das SARS-COV-2-Virus entwickeln? Wird es für lange Zeit ein tödlicher Begleiter der Menschen sein? Professor Dr. Michael Lässig prognostiziert für die Weltgesundheitsorganisation die Entwicklung von Influenza-Viren. Jetzt legt er wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit die Grundlagen, um den Weg des Virus zu bestimmen.
Vom Neubau der Theoretischen Physik der Uni würde niemand auf den ersten Blick annehmen, dass hier gegen das Corona-Virus gekämpft wird. Theoretische Physiker arbeiten mit Computern, mit mathematischen Modellen, sie rechnen und beschäftigen sich eher mit Naturkräften als mit Viren, so glaubt man. Trotzdem hat die Arbeit von Michael Lässig schon vielen Menschen das Leben gerettet.
Der Kölner Physiker rechnet jedes Jahr im Frühjahr aus, welche Virenstämme der Grippe im nächsten Winterhalbjahr gefährlich werden könnten. Seine Erkenntnisse fließen in die Auswahl der Impfstoffe ein, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dann empfiehlt. Nun hat sich der Wissenschaftler der Erforschung des neuen SARS-COV-2 Virus‘ zugewandt.

„Wir haben jetzt versucht, sehr schnell anzufangen, um zu schauen, was wir mit unseren Methoden dazu beitragen können“, erklärt Lässig. „Hier ging die Initiative von uns aus. Das ist im Moment bei sehr vielen Forschungsgruppen der Fall, die einfach fragen: Was können wir in diesem Moment beitragen?“ Und das sind die Werkzeuge, die er und seine Kollegen weltweit zur Bekämpfung der Grippe erfunden haben: Rechenprogramme und -modelle, Kenntnisse über die Genetik der Viren, über die Kräfte, die die Entwicklung eines Virus bestimmen. Es gibt internationalen Austausch und Organisation unter dem Dach der WHO. Damit steht der Forschung nun ein Instrumentarium zur Verfügung, um die Entwicklung und Verbreitung des SARS-COV-2-Virus zu untersuchen.
Influenzaviren sind alte Bekannte des Menschen
Lässigs normaler Job ist die Prognose der Grippe. Ein dreiviertel Jahr bevor die ersten Grippewellen über die Welt ziehen sagt er voraus, wie die Viren aussehen werden, die den Menschen gefährlich sein können. Dagegen gibt es Impfstoffe. Nur: Der Impfstoff muss auf die jeweilige Variante des Virus abgestimmt sein. Das ist nicht einfach, denn Viren können mutieren. Das stellt Forscher, WHO und biomedizinische Firmen vor ein großes Problem. Jedes Jahr tauchen neue Influenza-Viren auf, gegen die die bisherigen Impfungen schlechter wirken. Durch eine Kombination genetischer und physikalischer Methoden ist es möglich, die Evolution der Krankheitserreger vorherzusagen und zukünftige, besonders gefährliche Stämme ausfindig zu machen. Damit lassen sich jedes Jahr neue, wirksamere Impfstoffe erstellen.
„Influenzaviren sind alte Bekannte des Menschen, die gut erforscht worden sind“,
stellt Michael Lässig fest.
Man kennt ihr Genom, ihre Mutationen, man weiß, welche Einfallstore sie in die menschliche Zelle benutzen und wie unser Immunsystem sie erkennen kann.
„Bei Influenzaviren haben wir die Situation, dass das Virus schon seit Jahrzehnten in der menschlichen Bevölkerung zirkuliert. Das heißt, wir haben eine Geschichte der viralen Evolution, aus der wir lernen können“,
erklärt Lässig.
Viel Energie ist die letzten Jahrzehnte hindurch dafür investiert worden, die molekulare Struktur des Virus und seine Wechselwirkung mit dem menschlichen Immunsystem zu erforschen.
Ein Großteil der Erwachsenen einer Population sind schon gegen frühere Influenzaviren immun. Gefährlich bleibt die neue Influenza-Epidemie jeden Winter trotzdem, da sich jedes Virus in seinen Angriffsmechanismen von den früheren Viren unterscheidet und daher schlechter vom menschlichen Immunsystem neutralisiert werden kann. Gegen diese Viren wird dann geimpft. Die Voraussagen, die Wissenschaftler treffen können, sind in der Regel recht präzise und erstrecken sich in manchen Jahren über den nächsten Winter und damit die Grippewelle hinweg.
Neues Virus bedeutet komplett andere Dynamik
Doch SARS-COV-2 ist neu und noch nicht in dem Maße erforscht, wie es für Influenza gilt. Zunächst kommt es den Forschern deshalb darauf an, die virale Dynamik, das heißt die Verbreitung der einzelnen Varianten von SARS 2 und die Evolution, die das Virus dabei durchläuft, abzubilden.
„Das ist jetzt ein neues Virus und da ist erst einmal vieles anders in der epidemiologischen und evolutionären Dynamik als bei einem Virus, das seit Jahrzehnten in der menschlichen Bevölkerung zirkuliert“,
so Lässig.
Dafür untersuchen die Forscher die weltweit gesammelten Sequenzen des Virusgenoms und analysieren, wo sich Sequenzen unterscheiden und welche Sequenzen miteinander verwandt sind, das heißt durch zusätzliche Mutationen aus einander hervorgingen. „Diese Dynamik müssen wir erst einmal abbilden, um einen Überblick zu bekommen.“
Dabei greifen die Wissenschaftler auf die Werkzeuge zurück, die sie für Influenza entwickelt haben, wie zum Beispiel Visualisierungsverfahren.
„Da können wir sehen, was sich auf den Kontinenten und in den Ländern abgespielt hat. Wie die Dynamik aufeinandergefolgt ist, was die wichtigen Transmissionen waren, bei denen man sehen kann: Aha, diese Sequenzen sind wahrscheinlich aus jenen anderen Sequenzen auf einem anderen Kontinent hervorgegangen.“
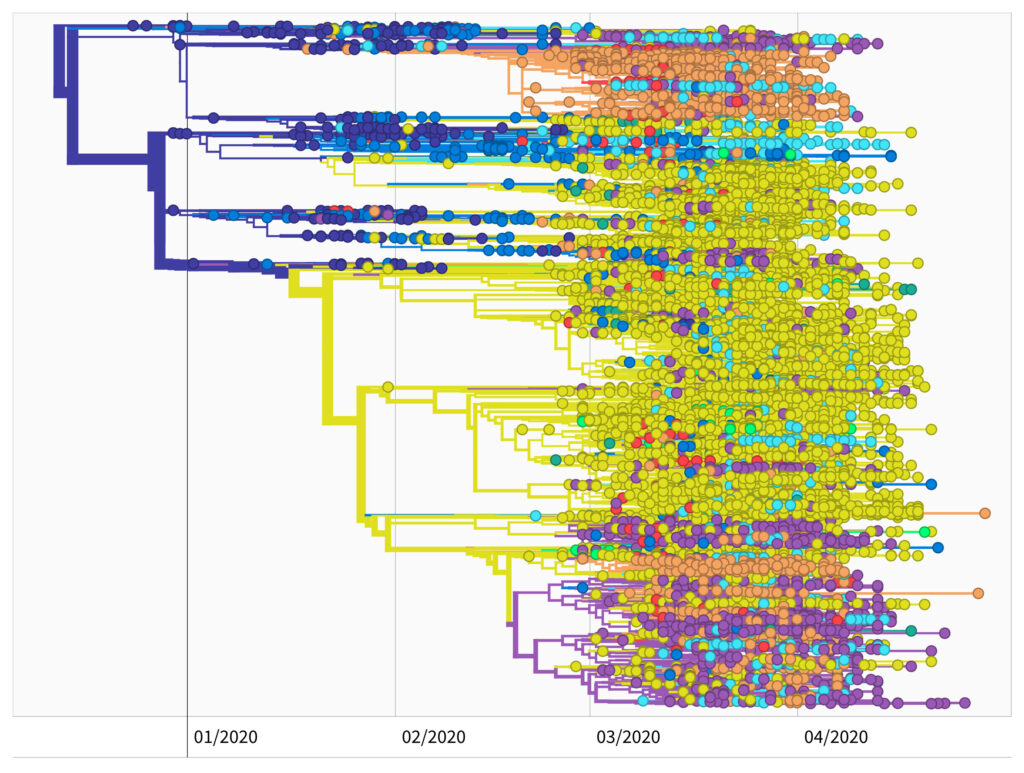
Verstehen, welche selektiven Kräfte den Virus evolvieren lassen
In einem zweiten Schritt kommt es darauf an zu verstehen, welches die evolutionären Kräfte sind, die diese Dynamik des Virus beeinflussen. „Darüber wissen wir noch sehr wenig“, muss der Physiker eingestehen, denn die teilweise Gruppenimmunität spielt bei Corona noch keine Rolle. Das heißt, noch ist nur eine sehr geringe Anzahl von Menschen gegen das Virus immun, weshalb sich Ausbreitung und Evolution ganz anders gestalten als bei Influenza.
„Die Dynamik des SARS-COV2-Virus ist vielleicht eine ganz andere und vielleicht kommt es für das Virus auf ganz andere Sachen an, um im Laufe dieser Pandemie zu evolvieren, als für z.B. Influenza. Das wollen wir im Laufe der Zeit herausfinden, und es gibt viele experimentelle Kollegen, die dazu jetzt wichtige Experimente machen. Und wir wollen versuchen, diese Ergebnisse in unsere Computational Pipeline einzuarbeiten, um zu schauen, ob wir da etwas Sinnvolles beitragen können.“
Wie sehr wird das Virus evolvieren?
Bei SARS-COV-2 kennt man die Stellen des Genoms, die für die zukünftige Evolution wichtig sein könnten, noch nicht. „Das ist die Herausforderung, die Informationen über die molekular wichtigen Stellen des Virus möglichst schnell zu bekommen.“ Ein großes Projekt, die Deutsche COVID-19 OMICS Initiative(DeCOI), soll Abhilfe schaffen, indem viele tausende von Einzelproben sequenziert werden. „Das ist wichtig, um das Virus genau kennenzulernen“, sagt der Physiker, der das Virus bekämpft. „Auch die Kölner Kollegen in der Medizin und im Zentrum für Genomik sind dabei.“
Die Evolution des Coronavirus steht erst am Anfang. Die intensiven Bemühungen, Impfstoffe herzustellen, konzentrieren sich daher auf den derzeit vorherrschenden Typ des Virus. Das muss allerdings nicht so bleiben, sagt Michael Lässig:
„Das ist eine ganz große Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten können: Wird dieses Virus evolvieren, so wie wir das von Influenza kennen? So dass es sich dann ständig erneuert? Oder wird es so wenig evolvieren, dass wir hoffen können, es mit einem einzigen Impfstoff besiegen zu können?“
Von Homeschooling bis Notfallbetreuung: Soziale Hilfen sind systemrelevant

Von Eva Schissler
Durch die Kontaktsperren wachsen in vielen Familien die Spannungen. Besonders hart trifft es Kinder und Jugendliche aus unterprivilegierten Familien. Sie drohen, in der Corona-Krise noch mehr den Anschluss zu ihren Mitschülern zu verlieren. Stoßen die digitalen Bildungsangebote hier an ihre Grenzen? Wie schaffen es Schulen und Soziale Dienste, Kinder und Jugendliche trotzdem zu erreichen? Nadia Kutscher, Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit, warnt vor einer Überlastung der Hilfesysteme.
Schulen und Kindertagesstätten bleiben vorerst geschlossen
Computer, Notebook, Tablet, WLAN-Anschluss – das sind die Voraussetzungen für den Schulersatz in Zeiten von Corona. Schulen öffnen ab Mai wieder schrittweise, Kindertagesstätten bleiben vorerst zu. Viele Familien sind bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen enttäuscht. Denn für die meisten sind „Homeschooling“ und Ganztagsbetreuung eine Herausforderung. Und wer Geldsorgen hat und auf engem Raum wohnt, ist ungleich stärker belastet. Außerdem sind nicht in allen Familien die Voraussetzungen für erfolgreiches digitale Lernen gegeben.
Neben einem Mangel an Raum und technischer Ausrüstung haben viele Eltern eingeschränkte Bildungserfahrung und bräuchten selbst Anleitung, wie sie ihre Kinder unterstützen können. „Viele Kinder und Jugendliche, die eh schon benachteiligt sind, drohen nun noch mehr Teilhabechancen einzubüßen“, warnt Nadia Kutscher. „Und je länger der Lockdown noch anhält, desto größer werden die Nachteile.“
Fehlender Anschluss in Notunterkünften
Auch für junge Geflüchtete hat die Schulschließung weitreichende Konsequenzen. Nadia Kutscher leitet seit Februar 2019 das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt Bildungsteilhabe Geflüchteter in digitalisierten Bildungsarrangements. Gemeinsam mit einem Team an der Universität zu Köln und an der Leuphana Universität Lüneburg erforscht sie, welche Bildungschancen digitale Zugänge besonders dieser Gruppe eröffnen können. „Dass wir die Auswirkungen der Schulschließung nun untersuchen können, ist natürlich ein völlig unerwarteter Nebeneffekt“, sagt Kutscher. Ihr Zwischenfazit: Besonders für Geflüchtete können die digitalen Angebote die Schule eben nicht kompensieren, denn dort haben sie Zugang zu Computern.
„Junge Geflüchtete sind oft besonders benachteiligt, denn in den Notunterkünften oder Wohngruppen haben die meisten nur das Handy, auf dem man nicht vernünftig seine Aufgaben erledigen kann“, argumentiert Kutscher. Manche Schulen behelfen sich damit, Pakete mit Arbeitsblättern in die Unterkünfte zu schicken. Die Kinder und Jugendlichen bearbeiten sie, fotografieren sie ab und schicken sie zurück an die Lehrkräfte. „Das ist natürlich nur eine Notlösung und langfristig völlig unzulänglich“, meint Kutscher.
Überlastete Notbetreuung
Schon früh nach der Schließung der Schulen und Kindertagesstätten äußerten Schulen und Sozialverbände ihre Sorge um einen möglichen Anstieg von Kindeswohlgefährdung in Familien. Seit Anfang April dürfen in NRW, nach Entscheidung des Jugendamtes, als gefährdet eingestufte Kinder ebenfalls an der Notbetreuung der Schulen und Kindertagesstätten teilnehmen, die bislang nur Kindern von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen zustand. Das entzerrt zwar in manchen Familien die Lage, doch die Entscheidung ist ambivalent zu bewerten, meint Kutscher: „Das hat auch Stigmatisierungspotenzial nach dem Prinzip: ‚Wer jetzt neu in die Notfallbetreuung gekommen ist, bei dem muss in der Familie etwas nicht stimmen.‘“

Durch wachsende Gruppengrößen in der Notbetreuung stehen Lehrer und Lehrerinnen, Erzieherinnen und Erzieher zudem vor der Herausforderung, die Einhaltung von Sicherheitsabstand und entsprechenden Hygieneregeln zu gewährleisten. „Gruppengrößen von 18 Kindern und mehr sind in manchen Einrichtungen schon keine Seltenheit mehr. Das gefährdet alle und führt zu noch größerem Druck, da im Kollegium zunehmend Krankheitsausfälle und Quarantäne zu einem Problem werden“, sagt Nadia Kutscher. Der schon vorher bestehende Fachkräftemangel kommt noch hinzu.
Es gibt auch noch das Telefon
Neben Schulen und Kindertagesstätten steht das soziale Hilfesystem ebenfalls vor Herausforderungen. In Zeiten von Corona den Kontakt zu den Zielgruppen zu halten, ist eine Gratwanderung. Für eine schnelle digitale Umstellung sind die Voraussetzungen in vielen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht gegeben. Einerseits ist kein Etat für die unter diesen Umständen erforderliche Hardware oder Software eingeplant. Andererseits sind diese Einrichtungen zum Datenschutz verpflichtet, der in den meisten digitalen Kontaktmöglichkeiten nur unzureichend gegeben ist.
Oft müssten auch Lizenzen erworben werden – für die wiederum keine Mittel vorhanden sind. „Das Digitale kann viele Dinge nicht kompensieren“, meint Kutscher. „Aber zwischen der persönlichen Begegnung und der Digitalisierung gibt es ja auch noch andere Mittel: zum Beispiel das Telefon.“ Dass telefonischen Beratungs- und Kontaktangebote schnell ausgebaut werden, hält Nadia Kutscher deshalb für essentiell, da diese gerade für benachteiligte Zielgruppen gut erreichbar sind.
Wie können Soziale Träger überhaupt an fachlich gesicherte Informationen und Standards in der Nutzung digitaler Angebote gelangen? „Hier bietet zum Beispiel die Website des Vereins Digitalcourage einen Überblick über datensichere Tools“, sagt Kutscher. Doch die Fachkräfte bräuchten selbst oft erst eine Einarbeitung in diese Tools. Darüber hinaus müssen sie überprüfen, wie ihre Zielgruppen überhaupt technisch ausgestattet sind, und ihr Angebot daran anpassen. Nicht alle haben zum Beispiel eine Internetflatrate. Kutscher: „Man muss als Trägereinrichtung gut überprüfen, was sinnvoll und praktikabel ist, denn die Zielgruppen sind zum großen Teil nicht ressourcenprivilegiert.“
Hilfe für die Helfer
Im Moment gilt es, viele dringliche Fragen zu lösen – auch über die digitale Umstellung hinaus: Wie kann man den Gesundheitsschutz der Fachkräfte und Klienten in den Einrichtungen und bei Familienbesuchen gewährleisten? Nicht zuletzt müssen laut der Professorin für Erziehungshilfe und Soziale Arbeit auch die Trägerstrukturen abgesichert werden. Denn sie stehen selbst unter wirtschaftlichem Druck und könnten in finanzielle Notlagen geraten.
„Neben den bereits entwickelten neuen Förderprogrammen brauchen wir ganz dringend auch ein Notprogramm für die Sozialen Träger“, warnt Kutscher. Die fordert auch das Bundesjugendkuratorium, dem Kutscher als Mitglied angehört. Sie resümiert: „Dass die Kinder- und Jugendhilfe höchst systemrelevant ist, dürfte in der Corona-Krise wohl allen klar geworden sein.“
(Stand: April 2020)
Isoliert, aber immerhin nicht allein
Ein Gespräch über die besondere Verbundenheit in digitalen Netzen
Ob „freiwillige Selbstisolation“ oder eine echte Quarantäne – selten haben wir so viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden verbracht wie unter Corona. Während sich viele Menschen fragen, wie sie parallel zur Aufmerksamkeit für die Kinder auch noch die Arbeitsmails abarbeiten sollen, sind Alleinstehende wirklich in der Totalisolation. Zumindest körperlich. Denn emotional teilen wir mehr oder weniger großzügig unsere Lebens- und Gedankenwelt über Applikationen auf dem Smartphone mit Freunden, Familie und Followern.
Spendet uns dieser permanente Austausch, der Blick auf “die anderen” etwas Trost in tristen Zeiten oder sollten wir das Endgerät auch mal getrost beiseitelegen und lernen, die Stille zu genießen?
Über diese Themen haben wir mit dem Sozialpsychologen Dr. Jan Crusius vom Social Cognition Center Cologne der Universität zu Köln gesprochen. Er forscht über soziale Vergleiche, Neid und andere Emotionen. Wenn er nicht gerade etwas über Haifische lernt.
Interview mit Jan Crusius

Herr Dr. Crusius, in Zeiten von Corona sitzen wir alle im selben Boot, denn wir müssen uns alle an dieselben Einschränkungen halten. Hat sich das Phänomen „Fear Of Missing Out“ (FOMO) – also die krankhaft neidische Angst, etwas zu verpassen – damit eigentlich erledigt?
Dr. Jan Crusius: Da bin ich skeptisch. Viel Forschung spricht dafür, dass das Vergleichen mit anderen einfach ein fundamentaler Bestandteil des menschlichen Denkens ist. Das ist vermutlich auch sehr nützlich: Gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt bieten uns andere Menschen wertvolle Orientierung und Bewertungsmaßstäbe. Geändert hat sich sicher, worüber wir uns mit anderen vergleichen.
Plötzlich sind andere Dinge wichtig: Die Timelines sind voll mit Sauerteig-Erfolgen, Screenshots aus Team-Meetings und virtuellen Spiele-Abenden. Das hat viel Gutes, aber vermutlich manchmal auch Nebenwirkungen, für diejenigen, die nicht dabei sind.
Mein persönliches FOMO-Erlebnis: Manche meiner Kolleg*innen scheinen gerade unglaublich produktiv zu sein. Sie engagieren sich mit großem Eifer in kreativen Forschungsprojekten, in denen es um die Psychologie rund um Corona geht. Da gibt es spannende Fragen und viel zu tun! Es macht ausschließlich Freude, da zuzusehen. Wirklich. Ich gönne Euch das.
Mittlerweile wird der Begriff „Social Distancing“ kritisiert, weil man paradoxerweise beobachten kann, dass die räumliche Distanz uns in eine neue soziale Nähe zusammenführt. Können Sie erklären, was da gerade mit uns geschieht.
Auch ich finde den Begriff nicht ideal. Alternative Vorschläge wie „physical distancing“ oder „distant socializing“ haben für mich einen besseren Klang. Anderseits ist das menschliche Bedürfnis nach Nähe und sozialer Verbindung so stark, dass der Begriff selbst vermutlich kaum etwas ändert.
Zum Glück haben wir die technischen Mittel, die soziale Nähe auch unter diesen widrigen Umständen möglich machen. Die Kehrseite dieser These: Auch ein besserer Begriff wird wenig gegen die Gefahren von sozialer Isolation ausrichten, die sich aus den Umständen ergeben. Einsamkeit ist ein starker Risikofaktor für die seelische und körperliche Gesundheit, das ist sehr gut belegt. Hier sind wir alle gefragt, den Kontakt zu Menschen aus unserem Umfeld zu suchen, die vielleicht besonders gefährdet sind, sich einsam zu fühlen.
Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste sind hierfür ja ein ideales Mittel. Trotz Isolation erfahre ich, was andere gerade so treiben. Ist es beschämend, wenn ich in meiner Single-Stadtwohnung doch ziemlich neidisch auf befreundete Familien auf dem Land gucke, die die Quarantäne scheinbar erfüllter gemeinsam im eigenen Garten verbringen?
Ja, das stimmt wohl, soziale Medien können auch ein Nährboden für schmerzhafte Vergleiche sein. Zumal einiges dafür spricht, dass die Realität dort noch mal gefiltert wird. Wir posten eben vor allem tolle Dinge in unserem Leben, nicht unbedingt die Misserfolge.
Ihr Beispiel spricht mir übrigens aus der Seele: Bei unserer Wohnung wird gerade die Fassade renoviert und sogar der kleine Balkon wird noch monatelang gesperrt sein. Für sehnsüchtiges Verlangen nach dem Glück anderer reicht mir der Blick auf die Terrasse der Nachbarn gegenüber. Diesen Vergleich grundsätzlich abstellen zu wollen, scheint mir ein aussichtsloses Unterfangen. Vielleicht beruhigt es manche Ihrer ebenfalls geplagten Leser*innen (so wie mich), dass diese unerfüllte Sehnsucht ein sehr alltägliches Gefühl zu sein scheint – auch wenn wir es nicht so gern zugeben.
Apropos Erfolge: Wenn alle auf Social Media ihre Entrümpelungs-, DIY- und Trainingserfolge aus der Quarantäne teilen, kann das auch ganz schön Druck und emotionalen Stress erzeugen. Wie schafft man es – ob in der Coronakrise oder auch danach – bei diesem permanenten „Vergleichsangebot“, das Social Media präsentiert, sich auf sich selbst zu besinnen?
Die Forschung spricht dafür, dass soziale Medien vor allem dann schädlich sein können, wenn man sie passiv konsumiert. Die positiven Wirkung sozialer Medien kann sich dann entfalten, wenn man sie aktiv nutzt, um soziale Beziehungen zu leben. Darüberhinaus gibt es viele wirksame Strategien, um mit belastenden Vergleichen umzugehen. Zum Beispiel gibt es Forschung, die zeigt, dass es schon sehr hilft, den Blick auf Andere gedanklich zu erweitern.
Ein einzelner Erfolg wirkt schon weniger eindrucksvoll, wenn ich an die Aufs und Abs denke, die die andere Person sonst so in ihrem Leben hat. Es hilft auch, sich auf eigene Stärken zu besinnen. Wem das nicht hilft: Es gibt Studien, die nahelegen, dass Abstinenz von sozialen Medien eine gute Maßnahme sein kann – vielleicht sind andere Formen der Kontaktaufnahme in diesen Zeiten dann besser.
Vergleiche haben doch bestimmt auch etwas Gutes, oder?
In meiner eigenen Forschung beschäftige ich mich mit der Motivation, die aus Vergleichen erwachsen kann. Man kennt das zum Beispiel aus dem Sport: Der schmerzhafte Vergleich mit anderen kann auch ziemlich anspornen. Das ist besonders dann so, wenn man sich auf Dinge konzentriert, die man selbst ändern kann. Manchmal fühlt es sich auch sehr gut an, wenn andere Menschen herausragend sind. Und zwar dann, wenn wir andere bewundern. Es spricht viel dafür, dass dieses positive Gefühl sehr inspirierend und auch sehr motivierend sein kann. Zum Glück können wir auch steuern, wie und mit wem wir uns vergleichen. Und Gelegenheit zur Bewunderung haben wir momentan auch viel.
Und wie vertreiben Sie sich die #StayHome-Challenge ohne Balkon?
Mir geht es als Familienvater so wie den meisten anderen Eltern: Ich habe mehr zu tun und zugleich weniger Zeit. Der Umstieg auf andere Arbeitsformen klappt ganz gut. Für meine Forschung habe ich auch vorher schon vor allem Online-Studien durchgeführt, auch Abschlussarbeiten von Studierenden kann ich gut über Videokonferenzen betreuen. Auf meine Seminare bin ich sehr gespannt, bin aber ganz zuversichtlich, dass sie in Online-Formaten funktionieren können. Viel zu tun habe ich gerade auch, weil ich als Herausgeber beim In-Mind Magazin, einem Projekt der Wissenschaftskommunikation in der Psychologie tätig bin.
Für mich ist schön zu sehen, dass es nicht nur ein großes Interesse an Psychologie rund um Corona gibt, sondern dass meine Kolleg*innen auch sehr motiviert sind ihr Wissen zu teilen. Da sind schon sehr viele Beiträge entstanden und in Vorbereitung. Nebenbei motiviere ich meine Söhne zu lernen – Aber auch ich lerne darüber viel dazu! Wussten Sie, was Haie für faszinierende Tiere sind? Wir feilen gerade an einem Lernplakat…
Das Gespräch führte Frieda Berg.
Hamsterkäufe – ein Versuch der Rebellion gegen die eigene Hilflosigkeit?
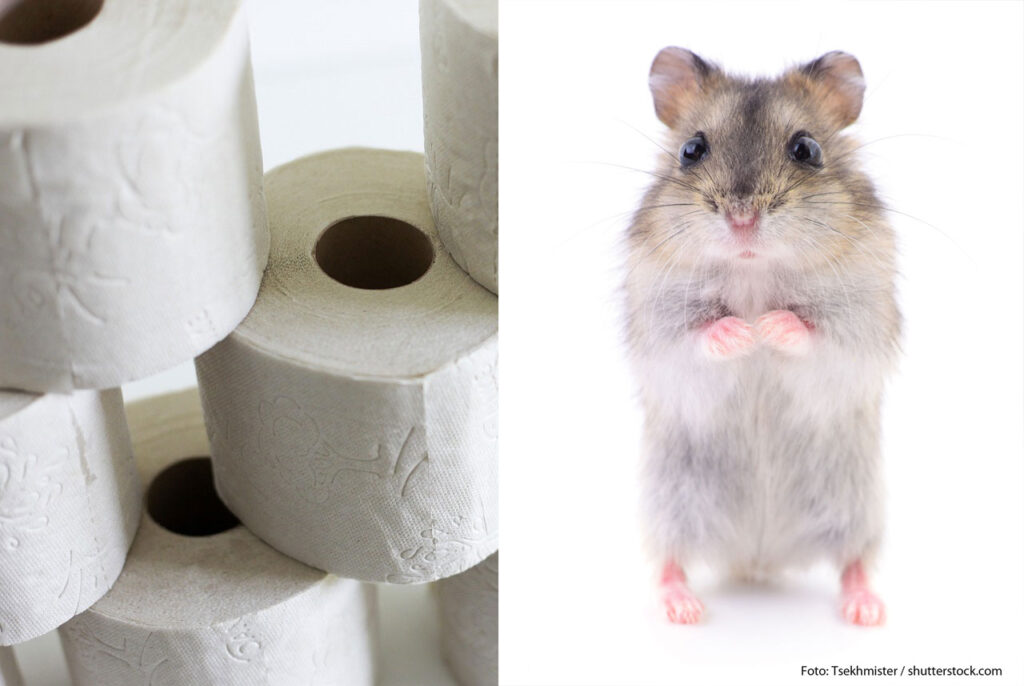
Von Sarah Brender
Die aktuelle Coronavirus-Krise bestimmt derzeit unseren Alltag. Dazu gehören durch Hamsterkäufe leergekaufte Regale. Ein Forschungsteam aus dem Bereich Marketing der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Köln hat mithilfe einer Umfrage herausgefunden, dass Käuferinnen und Käufer derzeit besonders oft Ängste als Gründe für vermehrtes Kaufverhalten angeben.
Die Brisanz des Themas “Hamsterkäufe” wird mit Blick auf aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) deutlich: Laut diesem stiegen die Verkaufszahlen für ausgewählte Produkte in der Woche vom 16. bis 22. März 2020, wie schon in den drei Wochen zuvor, auf ein extrem hohes Niveau. Beispielsweise war die Nachfrage nach Seife mehr als vier Mal so hoch wie in den sechs Monaten zuvor (+337 Prozent), während die Nachfrage nach Toilettenpapier mehr als drei Mal so hoch lag (+211 Prozent).
Die Marketingwissenschaftler Professor Dr. André Marchand, Juniorprofessor Dr. Martin Fritze und die Doktorandin Friederike Gobrecht von der Universität Köln gehen diesem Phänomen und seinen Ursachen mithilfe einer Umfrage nach.
Was sind die Gründe für Hamsterkäufe?
André Marchand erläutert:
„Es gibt zahlreiche theoretisch plausible Gründe für das derzeit stattfindende Hamsterkaufverhalten. In unserer Studie wollten wir herausfinden, was die Konsumentinnen und Konsumenten selbst über ihr mögliches eigenes Hamsterkaufverhalten und das anderer Menschen denken.“
Für die Umfrage befragte das Team 250 zufällig ausgewählte Personen in Deutschland am 23. März 2020 anonym und online. Das Alter der Befragten lag dabei bei 18 bis 71 Jahren (Mittelwert: 37), 44 Prozent weiblich, 56 Prozent männlich. Knapp 40 Prozent der Befragten wohnte zur Zeit der Umfrage in einer Großstadt, ähnlich viele in einer Kleinstadt und der Rest auf dem Land.
Nur 21 Prozent der Teilnehmer gaben an, selbst mehr Toilettenpapier als üblich gekauft zu haben. Professor Marchand erklärt dazu:
„Da das sogenannte Hamsterkaufen gesellschaftlich nicht erwünscht ist und als unsolidarisch wahrgenommen wird, könnte an dieser Stelle die Scham eine ehrliche Antwort verhindert haben. Mit für die Teilnehmer nicht eindeutigen Fragen zu anderem, sozial erwünschtem Verhalten, konnten wir solche Verzerrungen jedoch weitestgehend herausfiltern.“

Der am häufigsten genannte Grund bei etwas mehr als 50 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die selbst mehr als sonst gekauft hatten, war Sorge um die Verfügbarkeit. Die Forscher und Forscherin erklären diese Sorge durch die vielen Fotos leerer Regale und Hamsterkäufer und -käuferinnen in sozialen Netzwerken und sonstigen Medien.
Social Media als Verstärker der Ängste?
„Wenn die Menschen im Supermarkt nach den einprägsamen Bildern auf Social Media dann selbst vor leeren Regalen stehen, ist das aufgrund der Fläche, die Toilettenpapier einnimmt, besonders auffallend. So lassen sich mehr Menschen von den Hamsterkäufen anderer quasi anstecken, da sie den Eindruck bekommen, besser jetzt auch möglichst mehr zu kaufen, bevor die Produkte wieder vergriffen sind“,
sagt Professor Marchand.
Die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten, die selbst hamstern, führen als Gründe die Angst an, dass Supermärkte geschlossen werden könnten, oder die generelle Machtlosigkeit in der derzeitigen Situation. Von den übrigen Befragten, die selbst angeben nicht zu hamstern, glauben sogar 82 Prozent daran, dass dies ein Grund für das Hamstern bei anderen Menschen ist.
Weitere, von „Hamsternden“ genannte Gründe, sind die lange Haltbarkeit von Toilettenpapier, zusätzliche Käufe für Verwandte und Freunde sowie das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und Kontrolle durch Hamsterkäufe.
„Interessanterweise fanden wir keine Unterschiede beim Alter, jedoch bei der individuellen Mortalitätssalienz, also der individuellen Einschätzung und Sorge, dass man bald sterben könnte. Dies kann, muss aber nicht, vom Alter oder von Vorerkrankungen abhängig sein“,
sagt Juniorprofessor Martin Fritze.

Diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie, die angaben, selbst nicht mehr als sonst zu kaufen, vermuteten, dass es hauptsächlich am Herdentrieb liege, also sachlich unbegründet sei.
Mehr als die Hälfte der befragten Hamsterkäuferinnen und -käufer gaben auch an, andere Produkte wie Nudeln, Konserven und Hygieneartikel mehr als üblich gekauft zu haben. Bei den Ausgaben für digitale Dienstleistungen konnte das Team allerdings keine signifikanten Unterschiede im Kaufverhalten feststellen.
Professor Marchand zieht ein Zwischenfazit zur bisherigen Untersuchung, die noch ausgebaut werden soll:
„Unsere Studie hat bereits spannende Einblicke über die Beweggründe der Hamsterkäufer in Deutschland gegeben. Derzeit ist geplant, die Befragung auf andere Länder auszudehnen, um mehr über kulturelle und regionale Unterschiede zu lernen und nach der Coronakrise zu wiederholen.“
Eine Veröffentlichung der gesammelten Studienergebnisse soll danach folgen.
Neugierig geworden?
In einer weiteren Studie untersucht das Forschungsteam aktuell auch die Auswirkungen von Ausgangssperren auf den Konsum. Mehr Informationen zur Forschung im Bereich Marketing gibt es hier: https://marketing.uni-koeln.de/
Dürfen in der Corona-Krise auch bei uns die Krankenhäuser entscheiden, vorrangig junge Menschen zu behandeln?
Ein rechtlicher Beitrag von Professorin Frauke Rostalski

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat anlässlich der Corona-Krise kürzlich Empfehlungen für Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und der Intensivmedizin veröffentlicht. Auf Wunsch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zudem der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme abgegeben zur „Bewältigung dilemmatischer Entscheidungssituationen“.
Es geht ganz konkret um Behandlungsmöglichkeiten auf der Intensivstation, die für Corona-Patienten überlebenswichtig sein können. Wir brauchen dringend Regeln, denn gegenwärtig werden die maßgeblichen Akteure mit einer großen Zahl an weitreichenden und schwer zu treffenden Entscheidungen alleingelassen. Dabei ist unserer Rechtsordnung der Umgang mit Ressourcenknappheit generell nicht unbekannt. Zum Beispiel gibt es Richtlinien für die Verteilung lebensnotwendiger Organe. Aus den Vorschlägen der Divi geht hervor, dass der Behandlungserfolg maßgebliches Kriterium sein soll, wenn eine Priorisierungsentscheidung getroffen werden muss.
”Dem Staat ist es untersagt, das Leben seiner Bürger nach Wert oder Dauer zu unterscheiden”
Zusätzlichfindet sich folgender Passus: „Eine Priorisierung ist aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes (…) nicht zulässig allein aufgrund des kalendarischen Alters oder aufgrund sozialer Kriterien.“ Viel geholfen ist damit noch nicht. Die genannten Merkmale – Behandlungserfolg, Alter, soziale Kriterien – legen das Grundproblem offen: Sind lebenswichtige Ressourcen knapp, müssen Vorrangentscheidungen zugunsten des Lebens Einzelner getroffen werden. Das hat im schlimmsten Fall unmittelbar tödliche Konsequenzen für den nachrangig Behandelten. Diese Dramatik macht klare Regeln so schwierig – und doch müssen wir gerade hier tätig werden. Es genügt nicht, soziale Kriterien und das Alter pauschal als zweitrangig abzutun und in diesem Bereich nicht weiter ins Detail zu gehen. Zum einen wird dies dem Umstand nicht gerecht, dass bereits das für die Divi – zu Recht – maßgebliche Kriterium des Behandlungserfolgs entscheidend von diesen Faktoren abhängt: Wie alt jemand ist, hat in aller Regel einen erheblichen Einfluss darauf,welche Erfolgschancen eine Therapie für ihn birgt. Und auch soziale Faktoren spielen eine große Rolle. So ist etwa die Ernährung ein Hauptfaktor für die gesundheitliche Konstitution einer Person. Wie gut oder schlecht sich jemand ernährt, hängt oft von seinem sozialen Status ab. Wir müssen daher Farbe bekennen dazu, dass wir angesichts der Knappheit von lebensnotwendigen Ressourcen Vorrangentscheidungen zugunsten des Lebens bestimmter Personen treffen. Und vor allem: Farbe dazu, welche Personen das sein sollen.
Ein Beispiel: Patient A (35) und Patient B (60) weisen aus medizinischer Sicht identische Chancen auf einen Behandlungserfolg auf. Soll nunmehr das Alter eine Rolle spielen und Patient A bevorzugtwerden, weil er potentiell noch ein längeres Leben vor sich hat? Kann dies allgemein entschieden werden, oder sollte nicht auch berücksichtigt werden, dass der Gesellschaft eine altersmäßige Durchmischung gut tut? Oder dass ein älterer Mensch womöglich für Angehörige aufkommt, was bei dem kinderlosen Jüngeren nicht der Fall ist. Welche Rolle spielt es, wenn Patient A ein arbeitsloser Hartz IV-Empfänger ist, während Patient B als führender Virologe kurz davor steht, ein Medikament gegen Covid-19 zu entwickeln?
Generell erscheint es mir als Orientierung richtig, dass Krankenhäuser in Zeiten der Ressourcenknappheit diejenigen Patienten vorrangig behandeln, deren Chancen auf einen Behandlungserfolg am größten sind. Wenn Sie aber den Fall zugrunde legen, dass die Erfolgschancen bei zwei Patienten identisch sind, sehe ich mich zu einer Antwort auf Ihre Frage pauschal nicht imstande. Zumindest steht eines fest: Wie auch der Deutsche Ethikrat feststellt, kann und darf das Recht hier keine Handlungsanweisungen formulieren. Dem Staat ist es untersagt, das Leben seiner Bürger nach Wert oder Dauer zu unterscheiden. Aufgerufen sind aber etwa medizinische Fachgesellschaften, zeitnah konkretere Empfehlungen als die vorhandenen abzugeben. Bei ihrer Erarbeitung sollten wir alle durch den dafür notwendigen gesellschaftlichen Diskurs mithelfen.
Über die Autorin:
Professorin Dr. Dr. Frauke Rostalski ist Direktorin des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht der Universität zu Köln. Sie wurde von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum 30. April 2020 in den Deutschen Ethikrat berufen.
Dieser Beitrag ist zuerst im Kölner Stadtanzeiger erschienen.
Stresstest für die Lieferketten

Wie kommen Atemschutzmasken oder Webcams von der Fabrik zum Kunden? In einer globalisierten Wirtschaft erstrecken sich auch Lieferketten über die ganze Welt. Was passiert, wenn eine globale Gesundheitskrise droht, diese Lieferketten zu unterbrechen? Fabian J. Sting ist Professor für Supply Chain Management an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Er sieht in der Corona-Krise eine Chance für Unternehmen, ihre Lieferketten zu verbessern.
Interview mit Fabian J. Sting
Herr Professor Sting, wie gut sind Unternehmen auf Krisen wie die Corona-Pandemie vorbereitet?
Fabin J. Sting: Das ist schwer zu sagen, denn die jetzige Krise ist ein „Black Swan“ – etwas, was wir in diesem Ausmaß noch nie zuvor gesehen haben. Meistens verschiebt sich in einer Krise entweder auf der Seite des Angebots, oder aber auf der Seite der Nachfrage etwas. Im Moment spielen aber beide Seiten verrückt.
Was gilt es ganz grundsätzlich bei dem Aufbau einer Lieferkette zu beachten?
Im Supply Chain Management erforschen wir, wie man Prozesse gestalten kann, sodass Produkte in der richtigen Qualität und zum richtigen Zeitpunkt zu den Kunden kommen. Es geht ganz einfach darum, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen.
Das ist der Grundgedanke des „Just in time“-Konzepts, das vorrangig von japanischen Automobilherstellern geprägt wurde. Die Japaner verwenden dazu das Konzept des „Muda“ – alles, was keinen Wert schafft, ist Verschwendung und sollte eliminiert werden. Auch Lagerbestände können Verschwendung sein. Durch geringere Lagerbestände diszipliniert man sich zu einer schlanken Lieferkette. Dadurch kann man sich natürlich keinen Schlendrian und wenige Abweichungen erlauben. Die Lieferkette muss dann funktionieren wie ein Uhrwerk.
Warum sind Lagerbestände ein Problem?
Stellen Sie sich vor, Sie hätten große Lager an iPhones, die sie dann verkaufen wollen. Da besteht das Risiko, dass irgendwann niemand mehr diese iPhone-Generation haben will und Sie am Bedarf vorbei produziert haben. Dann bleibt man auf seinen Beständen sitzen.
Gleichzeitig zeigt sich genau darin in der jetzigen Krise eine Problematik. Ist die Lieferkette so verschlankt worden, dass gänzlich alle Material- und Kapazitätspuffer eliminiert worden sind, kann der „Just in time-Gedanke“ zu einem Eigentor werden. Wichtig ist hier, dass Unternehmen noch einen Plan B haben und flexibel genug sind diesen umzusetzen. Beispielsweise, dass sie Komponenten, Materialien oder Lieferwege kurzfristig anpassen können um bestmöglich auf die Situation zu reagieren.
Ist das reibungslose Funktionieren von globalen Lieferketten auch unter normalen Umständen störanfällig?
Wir unterscheiden da verschiedene Grade von Risiken. Es gibt auch im Normalfall Variationen, zum Beispiel Qualitätsschwankungen. Es kann sein, dass ein Lieferant Qualitätsprobleme hat. Da kann man dann operativ durch Qualitätsmanagement einwirken. Oder ein Lieferant hat vorrübergehend Kapazitätsengpässe. Das sind kleinere Beschaffungsrisiken, die es immer gibt. Auf der Nachfrageseite gibt es das genauso: Trotz immer weiter verbesserter Prognosemethoden weiß man nie genau, was bei den Kunden gut läuft.
Das Modelabel Zara ist ein gutes Beispiel dafür. Welche Farbe in einer Saison nachgefragt wird, ist vorab nie so ganz klar. Es kann sein, dass ein türkises T-Shirt gar nicht gut ankommt, das gleiche T-Shirt sich aber in der Farbe Flieder gut verkauft. Dafür baut man in die Lieferkette ein bisschen Flexibilität und Puffer ein. Zara macht das so, dass sie kleinere Produktionsstätten haben. Sie lassen eben nicht vor der Saison alles in China produzieren. Diese Stätten liegen teilweise in Europa und können bedarfsgerecht das nachproduzieren, was gerade gefragt wird.
Das hört sich doch auf für die aktuelle Situation nach einem guten Ansatz an.
Ja, das würde bei vielen Produkten auch helfen. Aber wir haben es im Moment mit einem noch viel größeren Risiko zu tun. Aber gehen wir zunächst mal eine Stufe weiter. Ein heftiger Störfall war zum Beispiel das Erdbeben und der Tsunami in Japan 2011. Natürlich hat dieses Ereignis auf vielen Ebenen Leid und Erschütterungen ausgelöst. Auf der Ebene der Lieferketten kam es zu dem Problem, dass eine Reihe von Lieferanten ausgefallen sind. Da zeigte sich, dass nicht nur Flexibilität und Schlankheit wichtig sind, sondern auch Redundanz. Man braucht also immer mindestens einen zusätzlichen Lieferanten, der unabhängig ist von demjenigen, der gerade ausgefallen ist. Man braucht weitere Spieler in der Lieferkette, die zur Not einspringen können, und zusätzliche Kapazitäten an anderen Orten auf der Welt.
Was für Erschütterungen in den Lieferketten hat die Corona-Krise bislang ausgelöst?
Im Moment sehen wir noch mal eine Steigerung. Wir nennen das eine fundamentale Disruption. Sie wirkt sich einerseits auf die Beschaffungsseite aus – also auf die Produktion. Zum Teil können Lieferanten nicht mehr produzieren, weil sie selbst Probleme haben, ihre Teile von den Zulieferern zu kriegen. Gleichzeitig sehen wir auch auf der Nachfrageseite wahnsinnige Probleme. Es gibt Nachfrageverschiebungen, irrationales Kundenverhalten, Rationierungen und Hamsterkäufe. Die normalen Muster von Angebot und Nachfrage stehen im Moment Kopf.
Was können Unternehmen tun, um diese Situation in den Griff zu bekommen?
Kommen wir noch mal zur Grundaufgabe zurück: Angebot und Nachfrage müssen irgendwie zusammengebracht werden. Weil beide Seiten im Moment verrückt spielen, ist das sehr schwierig. Jetzt braucht man die größtmögliche Flexibilität. Diejenigen, die Flexibilität schon eingebaut haben – die auf andere Teile zurückgreifen können, auf andere Produktionsmethoden, auf andere Technologien, um etwas zu produzieren – haben einen Vorteil.
Vor kurzem haben beispielsweise einige Unternehmen angefangen, Mundschutz im Drei-D-Druckverfahren zu produzieren. Das wäre jetzt die Möglichkeit, eine komplett neue Lieferkette aufzubauen. Was natürlich sinnvoll wäre, denn die bestehenden Lieferketten sind völlig überlastet.
Wäre das auch eine Option für Medikamente oder komplexere medizinische Apparate wie Beatmungsgeräte?
An der Stelle würde das womöglich weniger gut funktionieren. Bei komplexeren Produktionsprozessen ist die Flexibilität notgedrungen eingeschränkt. Hier braucht man größere Vorlaufzeiten, um überhaupt Kapazitäten aufzubauen. Bei der massiven Steigerung der Nachfrage wie im Moment bräuchten viele Firmen eigentlich fünf Jahre Vorlaufzeit. Und nicht alle Pharmazeutika sind generisch, also ohne Patentschutz, sodass man sie schnell produzieren kann.
Allerdings sehen wir im Moment auch unbürokratische Kollaboration zwischen Unternehmen, die eigentlich normalerweise konkurrieren. Das hat sich als ein effektives Instrument erwiesen um schnell Kapazitäten aufzubauen. Beispielsweise ist nach dem Erdbeben in Japan ein Konkurrenzlieferant eingesprungen, um Toyota unkompliziert auszuhelfen. Der ausgefallene Lieferant hat ihn dabei mit Konstruktions- und Produktionsplänen unterstützt. Am Ende haben alle dabei gewonnen.
Die Regierung der USA beruft sich mittlerweile auf Notstandsgesetze aus der Zeit des Koreakriegs, um zum Beispiel die Firma 3M dazu zu zwingen, mehr Atemschutzmasken für die USA zu produzieren und Exporte in andere Länder einzustellen. Auch wenn dieser Streit mittlerweile beigelegt ist – ob eine solche staatlich verordnete Notlieferkette die Lösung wäre, ist fraglich.
Wie sieht es mit der Abhängigkeit von China aus? Müsste nicht die Produktion vieler Güter, darunter auch Atemschutzmasken oder Medikamente, wieder auf viele Länder verteilt werden?
Ja. Allein in China gewisse Dinge zu beschaffen, kann natürlich unter Gesichtspunkten von Kosten und Effizienz kurzfristig rational erscheinen. Das Land ist die verlängerte Werkbank der Welt, dort kann man kostengünstig und effizient produzieren. Gleichzeitig ist ein alleiniges Beschaffen in China möglicherweise zu kurzfristig gedacht.
Ich beschäftige mich in meiner Forschung schon länger mit sogenannten Multi-sourcing-Strategien. Um sich abzusichern, haben Unternehmen oft weitere Lieferanten vor Ort, die in einer solchen Situation einspringen können. Optimalerweise sollte man die Lieferkette so anlegen, dass dieser Lieferant auch unabhängige Lieferwege hat, die nicht durch einen Kollaps in China beeinflusst werden. Ich glaube, dass die Krise das Risikobewusstsein in den Unternehmen noch einmal gestärkt hat und sie reine „Made in China“-Strategien möglicherweise überdenken werden.
Welche Bereiche sehen Sie im Moment als besonders gefährdet an?
Es wird vor allem Bereiche hart treffen, für die gewisse Regionen der alleinige Lieferant – oder auch Kunde – sind. Oder Bereiche, in denen Fachkräfte die alleinigen Fähigkeiten für die Herstellung eines Produkts besitzen. Zum Beispiel in der Elektronikindustrie sind Lieferketten zwar typischerweise lang und weitverzweigt, sie haben aber alle einen Engpass irgendwo in China.
Was können wir aus der Krise für die Gestaltung von Lieferketten lernen?
Wir beobachten gerade einen Stresstest für die Lieferketten, dessen Nachwirkungen wir uns ganz genau ansehen werden. Sicherlich gelten auch in Zukunft die Grundsätze von schlanken und flexiblen Lieferketten, genügen Ausweichlieferanten und dem Aufbau neuer Lieferketten, wenn bestehende überlastet sind. Aber ob man so eine Krise vollständig planerisch vorwegnehmen kann, ist zu bezweifeln. Wichtiger ist es eher, die Voraussetzungen zu schaffen, um flexibel reagieren zu können.
Wir sollten das Ganze auch nicht nur negativ sehen, sondern auch das Positive beachten. Diese Krise bewirkt, dass wir insgesamt innovativer werden. Wir haben gerade die Chance zu beobachten, wie Unternehmen und Lieferketten mit extrem hohem Risiko umgehen und welche gut zurechtkommen. Was für Ideen entstehen jetzt? Wo entstehen diese Ideen und wer setzt sie um? Für mich ist eine sehr interessante Frage, wie wir in Zeiten der Krise innovieren können.
Das Gespräch führte Eva Schissler.
Zur Person:
Professor Dr. Fabian J. Sting leitet zusammen mit Professor Dr. Ludwig Kuntz, Professor Dr. Ulrich W. Thonemann und Professor Dr. Horst Tempelmeier die Supply Chain Management Area der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Supply-Chain-Strategie, Technologie- und Innovationsstrategie, Produktionsmanagement und Prozessinnovation. Der Bereich an der Universität zu Köln gehört zu den führenden akademischen Institutionen auf den Gebieten Supply Chain Management sowie Produktions-, Service- und Logistikmanagement.
„Es ist die Natur eines Start-ups, schnell neue Ideen umzusetzen“
Geschäftsführer Marc Kley über den Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Exzellenz Start-up Center

Die Corona-Pandemie verursacht in allen Lebensbereichen Situationen, auf die sich zuvor niemand einstellen konnte und wirft für viele die Frage auf: Wie geht es weiter? Auch das Exzellenz Start-up Center (ESC) der Uni Köln und seine Start-ups versuchen, Wege zu finden, mit den sich schnell ändernden Begebenheiten umzugehen. Marc Kley, Geschäftsführer des ESC, kennt die Start-up-Szene an der Uni Köln und in der Stadt seit vielen Jahren. Im Interview berichtet er, wie das neugegründete ESC mit dieser Krisensituation umgeht, was das Projekt trotz der Corona-Pandemie plant und wie die Start-ups des ESC in dieser Zeit arbeiten.
Interview mit Marc Kley
Wie beeinflusst die Corona-Pandemie das Exzellenz Start-up Center und wie unterstützt das ESC-Team Gründungs- und Transferinteressierte?
Wir müssen uns auf die neuen Bedingungen einstellen und mit der Ungewissheit der nächsten Monate umgehen lernen. Da geht es uns nicht anders als allen anderen auch. Allerdings haben wir sehr schnell unsere Beratungsangebote auf Telefon- und Videokonferenzen umgestellt, sodass es keine Ausfälle unserer Services gibt. Wir unterstützen unsere Start-ups in ihren Home-Office-Situationen nach Leibeskräften. Da sind besonders unsere Start-up-Coaches sehr aktiv. Sie stehen auch hier täglich im Austausch mit den Start-up-Teams und beantworten drängende Fragen, finden Lösungen und vermitteln Ansprechpartner*innen aus unserem Netzwerk.
Ein gutes Netzwerk ist in diesen Zeiten sicherlich wichtiger denn je.
Es ist ein zentraler Aspekt unserer Arbeit, ein gutes Netzwerk zu schaffen, von dem unsere Start-ups profitieren können. Generell arbeiten wir mit unseren Partner*innen sehr eng zusammen. Das ist natürlich auch in Krisenzeiten ein großer Vorteil. Unsere Partner*innen wie die Wirtschaftsförderung der Stadt Köln, die IHK, der Digitalhub Cologne oder die NRW Bank bemühen sich, mit uns zusammen unseren Start-ups schnell Unterstützung und Kontaktpartner*innen für konkrete Probleme zu finden. Generell erlebe ich das Kölner Ökosystem und das Netzwerk der Kölner Hochschulen, zum Beispiel im Rahmen des hochschulgründernetz cologne (hgnc), als sehr aktiv und lösungsorientiert in diesen Zeiten.
Was können Hochschulen Gründungsinteressierten bieten – auch in diesen Zeiten?
Hochschulen als solches sind ein ideales Umfeld, da hier das wissenschaftliche Know-how liegt und viele Innovationen entstehen. Das schafft ein hervorragendes Milieu für wissensbasierte Gründungsideen. Gleichzeitig haben Gründungsinteressierte hier einen direkten Zugang zu Studierenden und Wissenschaftler*innen, die den Gründungsweg gerade gehen oder gegangen sind. Sie können sich bei ihnen Inspiration und Ratschläge für eigene Projekte holen. Gerade an der Uni Köln im Exzellenz Start-up Center schaffen wir diese Austauschplattform und ein Supportsystem. Studierende können Praktika bei unseren Start-ups machen oder als Mitarbeiter*in hineinwachsen. So erfahren sie hautnah gelebten Unternehmergeist und was es bedeutet, ein Start-up zu gründen.
An der Uni Köln ergänzen außerdem diverse studentische Initiativen wie der Entrepreneurs Club Cologne oder Enactus das Angebot. Hier bekommt man schnell Anschluss an eine vitale Community, die das Gründungsökosystem an der Uni bereichert.
Wie geht es den Start-ups des ESC zurzeit?
Unseren Start-ups geht es gut. Noch haben sie keine größeren Sorgen, sondern starten selbst eigene Aktionen, um anderen in dieser verunsichernden Zeit zu helfen. Unsere Start-ups LOLOCO und VYTAL haben beispielsweise Online-Initiativen ins Leben gerufen, um jeweils den deutschen Handel und die Gastronomie zu unterstützen. Es ist toll, zu sehen, wie unsere Start-ups ihr Know-how einsetzen, um in dieser Situation einen Beitrag zu leisten. Es gehört ja auch zur Natur eines Start-ups, schnell neue Ideen umzusetzen. Da werden zurzeit einige Projekte angestoßen, die in der Krise helfen sollen. Diese unterstützen wir natürlich als ESC auch sehr gerne.
Was ist für die nächsten Monate geplant?
Unabhängig von der Krise wollen wir unser Angebot, das wir mit dem GATEWAY Gründungsservice aufgebaut haben, erweitern und um diverse Bausteine ergänzen. Wir möchten an allen Stellen die Vernetzung und den Austausch stärken zwischen Wissenschaft, Industrie, unseren Start-ups und den Kölner Hochschulen, die im Gründungsbereich aktiv arbeiten.
Unser Beratungsangebot stärken wir bereits jetzt mit einem größeren Coaching-Team. Deshalb werden wir zukünftig auch individueller auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Start-ups eingehen können. Außerdem werden wir in den nächsten Monaten ein Accelerator-Programm neugestalten. Zudem erweitern wir unser Betreuungsprogramm und werden einen Alumni-Club für unsere Start-ups ins Leben rufen.
Zurzeit sind Veranstaltung und Lehrangebote in Präsenz an der Universität zu Köln nicht möglich. Allerdings bereitet die Universität gerade ein digitales Semester vor. Wie geht das Exzellenz Start-up Center mit der vom Land verordneten Kontakteinschränkung um?
Wir haben umgehend unsere Beratungsangebote für Start-ups und für alle Gründungsinteressierte auf telefonische und digitale Beratungen eingerichtet. Außerdem arbeiten wir sowieso in unserem ESC-Programm am Thema „Digitalisierung“. Einerseits werden wir Lehrangebote zu Digitalisierungskompetenzen für Studierende und Wissenschaftler*innen schaffen. Dazu gehören beispielsweise Themen wie App-Entwicklung oder Prototypenbau. Andererseits wird ein digitales Lehrangebot zum Thema „Strategic Business Toolkit“ in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erarbeitet, um den Studierenden flächendeckend und in Ergänzung zum Curriculum unternehmerisches Denken und Handeln zu vermitteln. Weitere Seminare und Workshops werden online folgen, sollte die Lage so anhalten.
Das Gespräch führte Julia Nüllen.
Über das GATEWAY Exzellenz Start-up Center (ESC)
Das GATEWAY Exzellenz Start-up Center (ESC) der Universität zu Köln fördert mit einem ganzheitlichen Ansatz Gründungen aus der Hochschule und eine Kultur des unternehmerischen Denkens und Handelns. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite https://www.gateway.uni-koeln.de/.
„Zwei Tage niedergeschlagen sein und dann nach kreativen Lösungen suchen“
Gründer im Audiointerview
Die Gründer Malte Hendricks und Tim Breker sprechen mit Andreas Klein darüber, wie ihre beiden Start-ups mit der Corona-Pandemie umgehen und wie sie beschlossen haben, aus einer schwierigen Situation das Beste zu machen. Mit dem Know-How aus ihren Start-ups unterstützen sie Gastronomien und Dienstleister*innen in Deutschland darin, dass es auch nach Corona weitergehen kann.

Anmerkung: Das Interview wurde am 16. April 2020 von Andreas Klein und Julia Nüllen geführt und referenziert die am 20. April beginnenden bundesweiten Lockerungsmaßnahmen.
Links:
Support your local Gastro in Köln aktiv als „Mersineins“:
https://www.mersineins.de/
https://www.loloco.app/herz-fuer-haendler/home
https://www.gateway.uni-koeln.de/






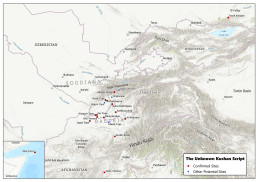























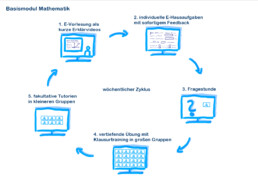
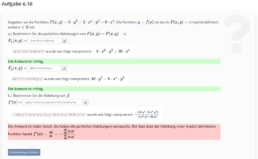
 Dr. Christoph Scheicher
Dr. Christoph Scheicher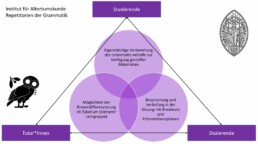
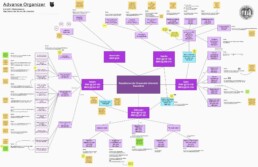

 Dr. Oliver Froitzheim
Dr. Oliver Froitzheim
 Michael Ehlscheid
Michael Ehlscheid